Vergesellschaftung statt Verdrängung? Oder: wer trägt eigentlich Verantwortung im Kollaps?
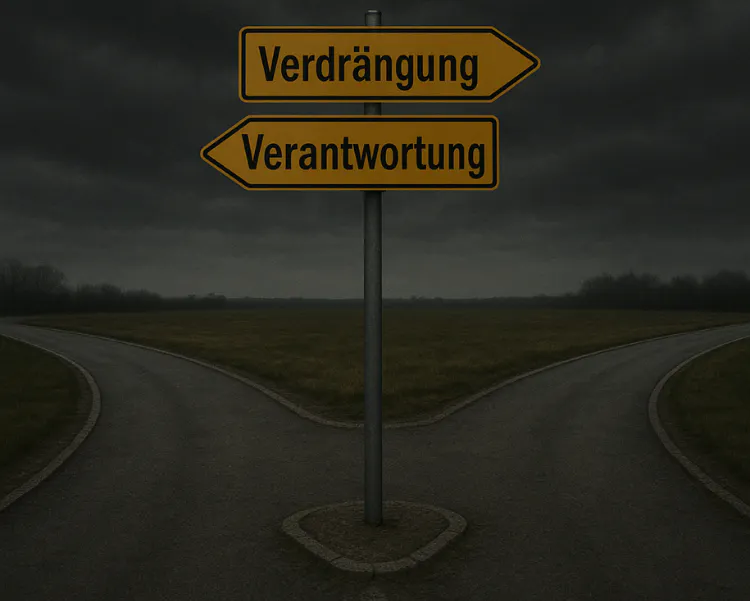
Quelle: chatgpt.ai (Öffnet in neuem Fenster)
05/06/2025
Liebe Leute,
wie ich letzte Woche schon schrieb, arbeite ich zur Zeit fast in Vollzeit an unserem Kollapscamp (Öffnet in neuem Fenster), weshalb meine Texte in den nächsten Wochen vermutlich etwas kürzer sein werden, als sonst, aber vielleicht auch ein bisschen oberflächlicher.
Bevor ich also ins heutige Thema einsteige, hier noch ein wichtiger Punkt re: Kollapscamp, der uns große Freude bereitet: unsere Anmeldung (Öffnet in neuem Fenster) ist zwar erst seit zwei Wochen online, aber von den 600 Plätzen, die wir zu vergeben haben, ist fast die Hälfte schon belegt! Vielenliebenriesendank von Uns für Euer Interesse und Euer Vertrauen, und falls Ihr Euch noch nicht entschieden habt, zum Camp zu kommen, dies vielleicht als zusätzliche Motivation: die Dynamik ist stark in der entstehenden Kollapsbewegung :)
Jetzt zur Sache: ich soll für die arranca (Öffnet in neuem Fenster), eine sehr kluge linke Zeitschrift aus dem Umfeld der Interventionistischen Linken (Öffnet in neuem Fenster), der ich seit langem nahestehe (full disclosure: ich war vor 12 Jahren oder so noch als “Einzelperson” in der IL organisiert), einen Text zum Thema “Vergesellschaftung (Öffnet in neuem Fenster)” schreiben. Genauer, ich soll nochmal erklären, warum ich nicht glaube, dass der Ruf nach Vergesellschaftung (von Produktionsmitteln, von Wohneigentum, von kritischer Infrastruktur) den Kern einer neuen, massenfähigen und gleichzeitig radikal-progressiven linken Agenda darstellen kann, wie das zum Beispiel Jan Groos in unserer hitzigen Diskussion in seinem Podcast Future Histories (Öffnet in neuem Fenster)vorgeschlagen hat.
Vergesellschaftung als Strategie
Nein, das hier ist (noch) nicht der Text, den ich der arranca einreichen werde, aber ich dachte mir, zwei Fliegen, etc. Die Frage nach Vergesellschaftung könnte auch Euch interessieren, die Ihr nicht so tief in der marxistischen/kommunistischen Tradition steht, wie die IL und ich, unter anderem, weil sie es mir erlauben wird, über eines meiner neuen Lieblingsthemen zu sprechen: darüber, dass im Kollaps fast niemand mehr wirklich “Verantwortung” übernehmen will, und dass wir unsim Schnitt lieber schämen und schuldig fühlen, oder halt verdrängen oder arschlochisieren, als gemeinsam die Dinge zu tun, die notwendig wären, um die Zukunft weniger scheiße zu machen.
Aber erstmal zurück auf Anfang: warum eigentlich jetzt wieder Vergesellschaftung? Denn die Idee der Vergesellschaftung von Produktionsmitteln war ja schon immer ein wichtiges Desiderat linker Politik. Dem sozialdemokratischen, oder auch “reformistischen” Flügel ging es üblicherweise darum, den Kapitalismus so einzuhegen, dass Arbeiter*innen und ihre Familien, und dementsprechend auch die gesamte Gesellschaft, nicht komplett der Willkür des Kapitals ausgesetzt waren, aber die Tatsache, dass den Kapitalisten (sic!) das Kapital gehöre, wurde nicht in Frage gestellt. Der antikapitalistische Flügel der Linken hielt dagegen, dass nur gemeinsame, demokratische Kontrolle über Produktionsmittel eine wirklich demokratische Gesellschaft produzieren könnte, ein Punkt, den Menschen wie Musk und Bezos und Quandt ganz gut bestätigen.
Im Niedergang der antikapitalistischen Linken seit spätestens 1989 verschwand die Vergesellschaftungsforderung dann erstmal weitgehend von der politischen Agenda, die Stunde der Privatisierung hatte geschlagen. Die darauf folgenden Jahrzehnte Neoliberalismus führten dann irgendwann zur Weltwirtschaftskrise 2007ff., nach der wir Linken es wieder wagten, die “Systemfrage” zu stellen: “schaut her, all diese private Kontrolle über Produktionsmittel hat riesiges Chaos produziert, wollen wir nicht lieber zentrale Ressourcen wie zum Beispiel Wohneigentum, Energieproduktion, Wasserversorgung, etc., zurück in die Hände der Gesellschaft legen, anstatt sie der Profitmaximierung (shoutout an Lisa Pöttinger (Öffnet in neuem Fenster)!) zu unterwerfen?”
Im Kern der Vergesellschaftungsagenda liegt also die politische Hypothese, dass Menschen lieber selbst Kontrolle über Produktionsmittel im allgemeinen, und kritische Infrastrukturen ausüben, als diese bei den Kapitalist*innen zu lassen, die uns in den vergangenen Jahr... ich sag mal -hunderten damit so drastisch in die Scheiße gefahren haben. Und das klingt ja durchaus erstmal vernünftig, wenn wir uns wuchtige Mobilisierungen wie die für den Brexit anschauen, deren zentraler Slogan “take back control!” war. Auch in Polen hat der rechte Präsidentschaftskandidat mit dem Ruf nach “Kontrolle” (für Warschau, anstatt für Brüssel) punkten können. Ein wichtiger Aspekt der Vergesellschaftungsagenda ist also der Glaube, damit dem rechten “hey, bei uns könnt Ihr Euch wieder stark fühlen, lasst uns mal ein paar Migranten oder Schwuppen vermöbeln!”-Angebot etwas ähnlich attraktives entgegensetzen zu können.
Wollen wir wirklich “Kontrolle” zurück?
Und das ist der Punkt, wo ich wiedersprechen muss: nein, liebe Genoss*innen, die Vergesellschaftungsagenda setzt der rechten Offensive nichts ähnlich starkes wie deren “let's BURN the others!” entgegen. Tatsächlich trägt der Ruf nach Vergesellschaftung, wenn er überhaupt irgendwas erreicht, zu genau der “Überforderung” bei, die einer der wichtigen Gründe für die weitere Verdummung und Arschlochisierung der Gesellschaft darstellt.
Frage: was meint Ihr eigentlich mit “Vergesellschaftung”? Klar, als Kommunist bin ich kein Fan des Privateigentums an Produktionsmitteln, aber ich hab einen Großteil meines klimaaktivistischen Lebens im Kampf gegen staatliche oder parastaatliche Energieunternehmen wie RWE oder Vattenfall verbracht, und traue einem verstaatlichten Unternehmen in einer Situation von Neoliberalismus und Faschisierung nur begrenzt bessere Entscheidungen zu, als privaten. D.h., Ihr müsst mit Vergesellschaftung auch einen Prozess beschreiben, in dem “die Gesellschaft” (wie auch immer genau organisiert) in der Lage ist, aktiv mitzubestimmen, was – bleiben wir mal bei Energie – für Energie das Unternehmen produziert, wie diese verteilt wird (technisch wie ökonomisch), usw, usw. Es bräuchte gesellschaftliche Entscheidungsprozesse für Energiequellen, Energienetze, Energiepreise und vieles mehr.
Und mal ganz abgesehen davon, dass es to my knowledge da bisher nur sehr ungenaue oder allgemeine Antworten auf diese Fragen gibt – also auf die “Organisierungsfrage”: wie genau würde denn die gesellschaftliche Kontrolle über die wichtigen kritischen Infrastrukturen ausgeübt werden? - ist meine viel größere Sorge die, dass in einer Situation allgemeiner Überforderung, und zunehmend unmöglicher Problemlösung, der Pitch “hey, setzt Euch doch gerne noch ein ein paar Extragremien, wo ihr politisch und technisch mega schwierige Fragen so entscheiden müsst, dass Euch Eure eigenen Leute hinterher nicht hassen!” kein sehr attraktiver ist. Er beinhaltet zu viel praktischen hassle, aber vor allem zu viel Verantwortung.
Denn, so meine These, “wir” wollen nicht wirklich echte “Kontrolle” zurück, wir wollen vor allem, dass uns keine schlechten Dinge mehr zustoßen, dass die Welt endlich weniger anstrengend wird, dass wir weniger arm sind, dass uns niemand etwas wegnimmt, dass unsere Nachbarschaften so werden/bleiben, wie wir sie haben wollen, wir wollen, dass die Welt nicht endet, und noch ganz viele andere völlig nachvollziehbare Sachen.
Aber wir wollen all dies nicht selbst organisieren müssen, weil es ja viel zu schwierig wäre. Genau darin liegt doch der psychologische Grund für den Wunsch nach einem Führer (Öffnet in neuem Fenster), der sich im Rechtsruck äußert, darin liegt der Grund für den Wiederaufstieg politischer Religion (Öffnet in neuem Fenster)im Kollaps. Wir wollen im Schnitt eher, dass jemand die Kontrolle übernimmt, und dann die in unserem Sinne richtigen Entscheidungen trifft, als diese wirklich selbst zu übernehmen, damit auch Verantwortung zu übernehmen, und dann am Ende mit der Verantwortung in der Hand dazustehen, wenn die Scheiße den Ventilator trifft.
_________________________________________________________________________
Ich finanziere meine politische Arbeit vor allem über diesen Blog, und wäre dankbar für Deine Unterstützung
_________________________________________________________________________
Die übliche linke Romantisierung der “Massen”
Wie üblich betrachte ich also die Frage der Vergesellschaftung aus der Perspektive der Subjekte, der Menschen, die wir organisieren müssten, die wir von unserer Agenda überzeugen müssten, um überhaupt gesellschaftlichen Druck in Richtung “mehr Vergesellschaftung” zu organisieren, und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie dauerhaft überforderte Menschen nach 40, 45 Jahren Neoliberalismus sich jetzt einfach umdrehen und sagen “na klar fangen wir jetzt wieder an, die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen, gerade in dem Moment, wo es inden Eisberg reincrasht.” Nur weil viele Menschen sagen, sie wollten die Kontrolle über ihr Leben zurück, bedeutet das noch lange nicht, dass dem auch so ist. Und wenn ich mir anschaue, wie die Gesellschaft sich verhält, anstatt immer wieder die Umfragen zu lesen, die in einer Verdrängungsgesellschaft zunehmend keine validen Resultate produzieren (weil Verdränger*innen ja keinen Zugang zu ihren “wahren” Gefühlen, Wünschen, Motivationen haben), dann sehe ich eine Gesellschaft, die keine Verantwortung übernehmen will, stattdessen allerlei Sündenbocken allerlei Schuld zuschiebt, und sich damit wohler fühlt, als wenn sie wirklich versuchen würde, ihre Probleme zu lösen.
In dem Sinne ist die Vergesellschaftungsagenda vor allem auch ein weiterer Versuch meiner antikapitalistischen Genoss*innen, sich die Massen schönzusaufen, ihnen Motivationen und Wünsche zu unterstellen, für die es in der empirischen Realität kaum Belege gibt. Stattdessen sehen wir allüberall Belege für die zunehmende Hinwendung zu Irrationalität und Faschismus. Der Faschismus ist die Abwendung von aller Verantwortung, zumindest dieser revolutionär-maskulinistische Faschismus. Das macht ihn so attraktiv, s. die Schiff-und-Eisberg-Metapher oben. Alle anderen politischen Positionen reden irgendwo von Verantwortung für die Zukunft, die junge Generation, andere Menschen, etc. Der Faschismus ist die Reinwaschung von jeglicher Verantwortung, deswegen sieht man es Trump und Bukele auch so sehr an, dass sie unglaublichen Spaß haben, wenn sie sagen “wer von uns ist für Kilmar Garcia verantwortlich? Natürlich keiner!'”
Deswegen glaube ich nicht, dass “Vergesellschaftung” eine massenfähige Agenda ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Forderung falsch ist, auch nicht der Kampf dafür, aber wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass wir damit sehr weit kommen werden. Denn Verantwortung übernehmen liegt halt immer weniger im Zeitgeist.
Mit verantwortungsgestressten Grüßen,
Euer Tadzio


