Vier Schwestern
Der ursprüngliche Plan (Opens in a new window) war, diesen Newsletter an einer Stunde am Sonntagabend zu schreiben und ihn einige Tage später zu verschicken. Nun ist es Freitagabend, 22.26 Uhr und meine sechsjährige Tochter schläft erst seit einigen Minuten. Dafür durfte ich dabei zusehen, wie sie heute ihre ersten Protest-Plakate gemalt hat und war ein bisschen stolz. Es ging um Katzen (Opens in a new window). Nicht um Corona.
Da mir aber einige Dinge zur SZ-Kolumne von dieser Woche „Ist es radikal, zuhause abzutreiben?“ (Opens in a new window) noch durch den Kopf gingen, bin ich noch mal an den Schreibtisch zurückgekehrt.
(Nach einer weiteren Care-Verzögerung erscheint der Newsletter nicht wie sonst am Samstagmorgen, sondern *jetzt*, da ich ihn schließlich am Samstagabend ab 22.32 Uhr zu Ende geschrieben habe.)
Ein Freund hat vor einigen Jahren einmal zu mir gesagt, man könne zwar aus der katholischen Kirche austreten, aber man bliebe immer Katholik*in. Ich bin vor etwa 15 Jahren bei einem Berliner Amtsgericht ausgetreten und war ein wenig enttäuscht, dass ich dort nicht nach den Gründen gefragt wurde. Den Wunsch auszutreten hatte ich, seitdem ich etwa 14 Jahre alt war, habe es aber nicht getan, um weiteren Konflikten mit meiner Familie aus dem Weg zu gehen. Religion war dann sogar mein Abiturfach, da der Unterricht des Lehrers, der Sozialwissenschaften unterrichtete, so grauenvoll war, dass ich das Fach, was mich inhaltlich so viel mehr interessierte, schließlich abwählte und meine Punkte im katholischen Religionskurs sammelte. Ich nahm für erträglicheren Unterricht in Kauf, dass ich die Kritik, die ich an der Kirche und im speziellen am Papst in die Klausuren schrieb, rot angestrichen zurückbekam.
Ich würde noch heute argumentieren, dass eine Glaubensgemeinschaft, in der Nächstenliebe ein zentraler Wert ist, Schwangeren zugestehen müsste, eine Schwangerschaft nicht auszutragen.
Dass ich meine katholische Prägung nicht loswerde, habe ich zuletzt im Sommer 2019 gemerkt, als ich bei einem Dreh für das Stern-Format „Diskuthek“ war und die Einladung angenommen hatte, mit einer Abtreibungsgegnerin zu streiten. Ich hatte länger überlegt, ob ich die Diskussion überhaupt zuzusagen wollte und mich schließlich dafür entschieden. Denn die Sendung erreicht zum einen sehr junge Zuschauer*innen, zum anderen sollte das Gespräch geschnitten werden. Die Redaktion blendet bei dem Format zudem einen Faktencheck ein, um falsche Behauptungen direkt richtig zu stellen. Wer dort mit Absicht Fehlinformationen verbreiten will, wie Abtreibungsgegner*innen es oft tun, hat deutlich schlechtere Karten als in Live-Sendungen. (Die Sendung könnt ihr hier (Opens in a new window) anschauen.)
Was mich aber die Diskussion über begleitete, war, dass ich seit ein paar Tagen wusste, dass ich wieder schwanger war. Ich war unsicher und verletzlich, denn ich hatte lange auf diese Schwangerschaft gewartet. Es war fast genau zwei Jahre her, dass ich aufgrund einer Eileiterschwangerschaft (Opens in a new window) notoperiert werden musste und ich habe danach sehr mit der traumatischen Behandlung im Krankenhaus und mit dem Verlust des Kindes gekämpft. Und nun saß ich da und stritt mich mit einer Fundamentalistin darüber, dass Schwangere jederzeit und legal das Recht haben sollten, eine Schwangerschaft abzubrechen. ,Bringt das nun Unglück?‘ Diese Frage brachte der Rest-Katholizismus immer wieder in meinen Kopf, während ich gleichzeitig innerlich mit den Augen rollte, diesen Gedanken überhaupt zu denken. Die Diskussion war ohnehin anstrengend, da die Abtreibungsgegnerin ohne Punkt und Komma redete, ich sie unterbrechen musste, um zu Wort zu kommen und es ein heißer Augusttag war. Ich fuhr erschöpft nach Berlin zurück und fragte mich, ob die Teilnahme an der Sendung die richtige Entscheidung gewesen war. Irgendwann möchte ich einen Exorzismus für meinen Katholizismus.
Die wenige Tage alte Schwangerschaft von damals ist gerade zehn Monate alt geworden und lacht, wenn man sie kitzelt.
Obwohl die Sendung bei Youtube vor über einem Jahr online ging, bekomme ich bis heute jede Woche mehrere Zuschriften von meist jungen Menschen, die sich für die Sendung bedanken. So werde ich immer wieder daran erinnert, dass es nach wie vor viele Menschen gibt, die unbeabsichtigt schwanger werden und vielleicht außer der Beratungsstelle niemanden haben, der ihnen versichert, dass was auch immer sie entscheiden, okay sein wird.
Die pro familia-Beraterin, mit der ich für die Kolumne telefoniert habe, erzählte mir, dass diejenigen, die gerade in der Beratung anrufen (die Beratung findet in der Pandemie vor allem telefonisch statt), dies von Bushaltestellen aus tun, aus Treppenhäusern, eingeschlossen im Bad, weil sie das Gespräch und den Abbruch geheim halten wollen. Ihr Zuhause ist nicht der Ort, an dem sie diese Telefonate führen können.
Ich habe die letzten Jahre viel in Online-Gruppen über Fehlgeburten und unerfüllte Kinderwüsche gelesen. Neben all dem Support, den die Menschen sich dort gegenseitig geben, habe ich immer wieder eine bedrückende Beobachtung gemacht: Die Frauen, die Fehlgeburten erlebt haben oder seit Jahren versuchen schwanger zu werden, fühlen sich durch die Schwangerschaften von anderen, aber vor allem durch die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch im Freund*innenkreis stark verletzt. Sie werten die Abtreibung einer anderen Person nahezu als persönlichen Angriff „Wie kann sie nur, sie weiß gar nicht, was ich dafür geben würde, schwanger zu sein“, liest man dann und auch immer wieder abschätzige Kommentare über Familien mit sehr vielen Kindern. Der Schmerz, selbst kein Kind zu haben, übersetzt sich in Wut gegenüber anderen.
Auf die SZ-Kolumne von dieser Woche habe ich auch ein paar Nachrichten über Instagram bekommen von Menschen, die sagten, dass sie mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch nicht gut umgehen können, weil sie sehnlichst auf eine Schwangerschaft warten. Ich weiß selbst, wie hart das sein kann, wenn alle anderen schwanger werden und man selbst nicht. Aber man wünscht sich ja nicht das Kind zu bekommen, das andere nicht austragen wollen. Man möchte ein eigenes. Die Schwangerschaft der anderen, ob sie ausgetragen wird oder nicht, hat nichts damit zu tun, dass man selbst nicht schwanger wird.
(Dass die meisten Menschen sich ein Kind wünschen, dass sie selbst geboren oder gezeugt haben, sieht man auch in der Statistik der Adoptionen (Opens in a new window), die mit den Fortschritten, die die Reproduktionsmedizin gemacht hat, stark gesunken sind.)
Bei der Kolumne (Opens in a new window) war mir daher der Schluss, der Fehlgeburten und Abbrüche als Schwestern beschreibt, so wichtig – und unerfüllte Kinderwünsche und sogar traumatische Geburtserfahrungen gehören als dritte und vierte Schwestern noch dazu. Sie haben nicht nur gemeinsam, dass Betroffene diese Erlebnisse oft und lange mit sich allein aus machen, sondern vor allem, dass die Gesundheitsversorgung an diesen Stellen wenig empathisch ist und eine gute Versorgung auch kein gesundheitspolitisches Ziel ist bzw. die Gesundheitspolitik der letzten Jahre nicht interessiert hat. In dem sehr empfehlenswerten Buch von Jennifer Block „Why healthcare needs a feminist revolution“ (Opens in a new window) schreibt sie:
„The stigma and regulation of abortion have impacted miscarriage treatment, stalling innovation there, too: anything considered an abortion procedure has been ghettoized or even restricted.“
Zudem schreibt Block, dass Schwangerschaftsabbrüche in den USA bis ins 19. Jahrhundert zu den Gesundheitsleistungen von Hebammen zählten und kriminalisiert wurden, um Hebammen aus der Gesundheitsversorgung zu verdrängen. Bei Longreads.com könnt ihr dazu von ihr den Text „The Criminalization of the American Midwife“ (Opens in a new window) lesen.
Der Wunsch nach einem Schwangerschaftsabbruch – der nicht immer leicht zu organisieren ist – und der Wunsch, bei einer Schwangerschaft von einer Hebamme begleitet zu werden – der aufgrund des Hebammenmangels nicht immer erfüllbar ist – liegen politisch viel näher beieinander, als man vielleicht denken würde.
Diejenigen, die nicht schwanger sein möchten, die, die gern schwanger sein würden und die, die schwanger sind, haben gemeinsame Interessen: eine gute gesundheitliche Versorgung.
Abortion is healthcare.
Davon, dass Schwangerschaftsabbrüche auch respektvoll verlaufen können, erzählt die Autorin Asal Dardan in ihrem gerade erschienenen Buch „Betrachtungen einer Barbarin“ (Opens in a new window). Hier könnt ihr ein Interview (Opens in a new window) mit ihr hören, in dem sie u.a. über den Text spricht.
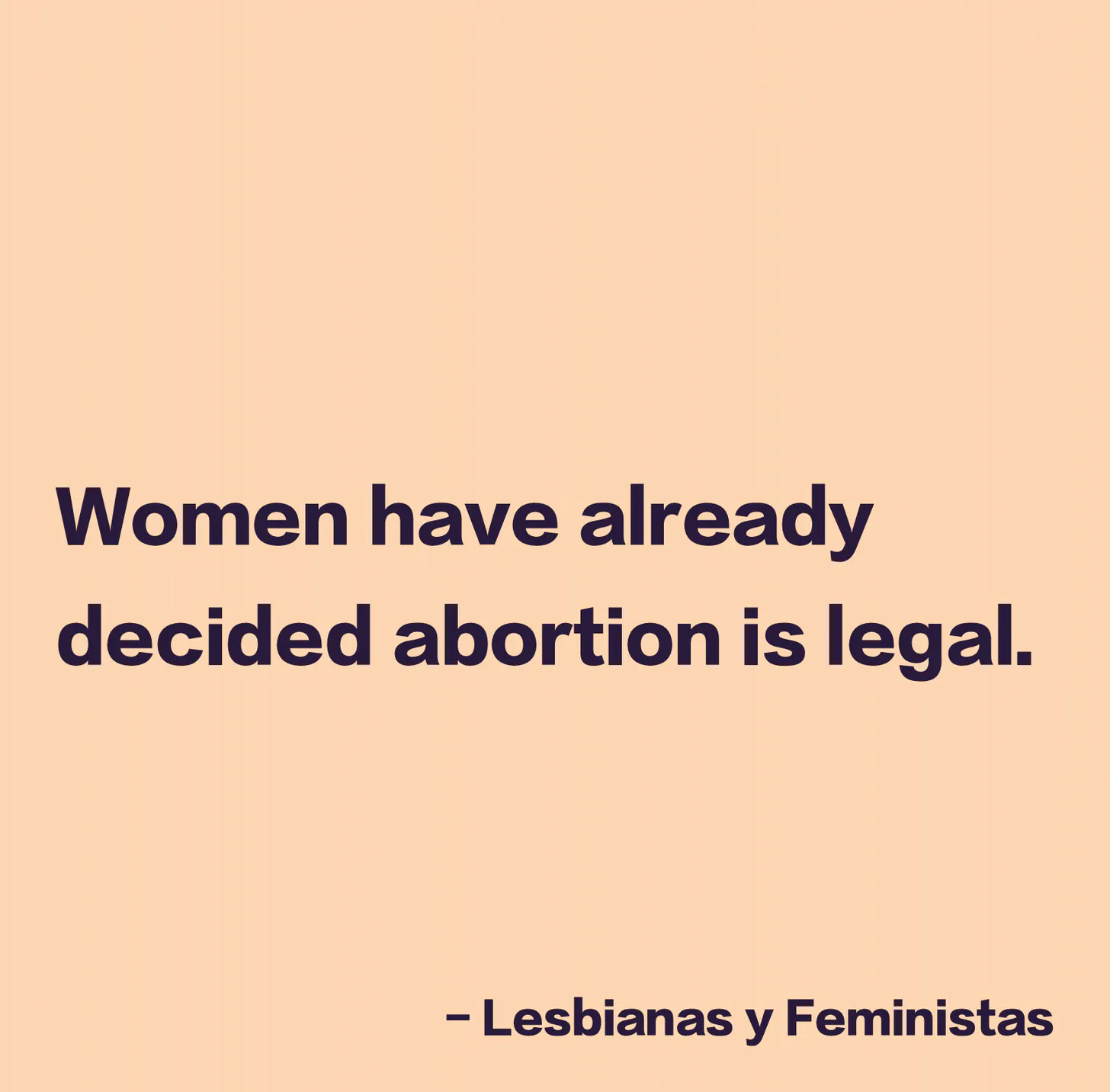
Aus: Strategies of the Abortion Rights Movement in Argentina. (Opens in a new window)


