Kirmesponys in der Sonne
Der Sonntagabend ist eine der Zwischenzeiten, die ich jedes Mal mit Erwartungen überfrachte. Ich möchte die Woche abschließen, noch einmal ein wenig Ruhe haben, bevor die neue beginnt. Dabei ist der Sonntagabend wie all die anderen Abende vor ihm und nach ihm. Welcher Wochentag gerade ist, ist nach knapp einem Jahr Pandemie und Zuhausebleiben kaum noch spürbar. Eine Stunde will ich mir jeden Sonntagabend nehmen, um diesen Newsletter zu schreiben, und schon beim ersten Mal klappt es nicht. Den ersten Satz habe ich am zehnten Januar geschrieben, den letzten am 15.
Nachdem das Baby an diesem Sonntag eingeschlafen ist – es ist etwa 21.30 Uhr – und ich mich gerade mit einem Tee an den Schreibtisch gesetzt habe, kommt mein Freund und sagt mir, dass meine ältere Tochter wolle, dass ich noch einmal zu ihr komme. Auch sie schläft noch nicht, obwohl sie normalerweise früher einschläft. Während ich mit den Augen rolle, seufze und aufstehe, beginnt auch das Baby wieder zu weinen.
Die einzige Zeit, in der ich in den letzten Monaten nicht müde war, waren die ersten Wochen im April 2020, nach der Geburt meines zweiten Kinds, als ich unfassbar_glücklich und dauergrinsend mit ihm im Bett lag und die Hormone genossen habe. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal so energiegeladen, gelassen und ganz bei mir selbst gefühlt habe. Für ein paar Tage habe ich tatsächlich vergessen, dass draußen eine Pandemie begonnen hatte. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, habe ich das Gefühl, von einem idealen Drogentrip zu sprechen. Ich wollte, dass dieser Zustand niemals aufhört, während ich wusste, dass er aufhören wird.
Ich versuche mir diese Wochen im April und Mai 2020 in Erinnerung zu rufen und mir zu sagen, dass ich nicht den Rest meines Lebens erschöpft sein werde, vielleicht nicht einmal den Rest dieser Pandemie. Dass es nur der Winter ist, das Zahnen und das permanente Unterbrochen-Werden bei allem, was ich tue. Es ist jetzt 22.37 Uhr und das Baby ist wieder wach.
Das Baby scheint zu wissen, dass ich ein Nachtmensch bin. In der Zeit, in der es ganz still ist draußen und andere schlafen, kann ich am klarsten denken. Weil ich ein Nachtmensch bin, will das Baby spätabends bei mir sein und nur bei mir. Das bilde ich mir ein. Tagsüber verbringt es gerade die meiste Zeit mit seinem Vater, trinkt mit ihm das Fläschschen und schläft auf ihm und neben ihm. Abends nicht. Abends interessiert es sich nur für Brüste. Deswegen sieht mein Schreiben am Abend so aus, dass ich in dem kurzen Zeitraum, in dem ich am Schreibtisch sitze, manchmal zwei oder drei Mal aufstehe, um das Baby zu beruhigen. Zurück am Schreibtisch habe ich vergessen, an welchem Gedanken ich gerade saß und beginne von vorn.
Wenn Leute mich zu meinen Texten im SZ-Magazin fragen, wann ich all diese Texte und Bücher lese, die ich dort zitiere, da ich doch zwei Kinder habe, ist die Antwort: bei der Einschlafbegleitung. Ich lese all diese Longreads und Interviews und Studien, wenn ich im Kinderbett neben meiner Tochter liege oder das Baby trinkt und trinkt. So kommen einige Stunden in der Woche zusammen. Vermutlich lese ich deshalb Bücher nach wie vor am liebsten gedruckt, weil sich das nach Freiheit anfühlt und das Lesen an der Screen immer nach Kinderzimmer und Stillen. Momentan versuche ich, die letzte Stunde vor dem Schlafen nur noch gedruckte Bücher zu lesen, da ich zuletzt sogar dann wach gelegen habe, wenn das Baby schon lange fest schlief. Die Pandemie macht müde und gleichzeitig schlaflos.
Nicht nur das Baby ist jetzt, kurz vor 24 Uhr, wieder wach. Auch meine Tochter steht auf einmal in der Tür und grinst verschlafen. Dieser Newsletter sollte eigentlich eine Selfcare-Kritik werden, aber ich schweife ab, da selbst diese eine Stunde am Sonntagabend in kleine Teile zerfällt, mittlerweile viel länger ist als eine Stunde und es kaum möglich ist, eine Idee zu Ende zu denken. So ist das Leben mit Kindern. Man läuft mit halb zu Ende gedachten Sätzen und Ideen herum, räumt die Spülmaschine zur Hälfte aus, befüllt die Waschmaschine und stellt sie nicht an und füllt das Milchpulver in den Espressokocher. Es ist purer Zufall, wie ein Abend verläuft. Nicht jeder Abend ist so. Wenn die Kinder früh einschlafen, bin ich manchmal überfordert über die plötzlich auftauchende freie Zeit und habe keine Idee, was ich nun mit ihr anfange. Gleichzeitig denke ich, dass ausgerechnet dieser Sonntagabend so unruhig ist, mit mehr Unterbrechungen als andere, da meine Kinder mich von noch einem Projekt abhalten wollen. Ich habe ohnehin zu wenig Zeit. Warum auch noch ein Newsletter?
Vielleicht, weil die übrige Zeit am Abend nicht für andere Dinge taugt als schreibend nachzudenken ohne den Druck, dass der Text etwas Stimmiges ergeben muss. Nur Tweets zu schreiben macht mich unruhig. Threads behindern für mich ein flüssiges Schreiben. Die Idee, doch am Abend noch weiter zu arbeiten, um tagsüber mehr Zeit für die Kinder zu haben … für mich funktioniert sie gerade nicht, auch wenn der Abend meine liebste Schreibzeit ist. Jetzt, im Winter, in der Pandemie, in der Babyzeit, bin ich abends geistig nur noch wenige Minuten fit genug, um klar zu schreiben. Am nächsten Tag ergeben die Sätze keinen Sinn mehr. Ich mache Überweisungen und kaufe noch ein Buch und noch ein Buch im Online-Antiquariat und Vitamine und noch ein Schleich-Pferd und schreibe auf meine To-Do-Liste, nun endlich die eine Freundin zurückzurufen. Dass der Kontakt zu Freund_innen auf diese Liste muss, ist schlimm genug, aber auf diesen Listen steht mittlerweile nahezu alles, was ich tagsüber machen möchte, weil der Corona-Mental-Load mein Erinnerungsvermögen auf null reduziert hat. Vielleicht ist deswegen seit fast einem Jahr März. Bewege ich mich ein Tab weiter, habe ich vergessen, was ich gerade machen wollte. Überall kleben Zettel mit Dingen, die ich noch tun will. Seit zehn Monaten habe ich kaum einen Tweet ohne Tippfehler geschrieben. Manchmal lösche ich einen Tweet vier Mal, bevor er ohne Fehler ist. Mittlerweile lasse ich ihn meistens so.
Vermutlich ist es auch das Doom-Scrolling auf Twitter, weshalb meine Aufmerksamkeitsspanne etwa eine halbe Headline lang ist. Ich twittere seit 2008 und habe 2020 erste Mal Twitter kurz vor Weihnachten von meinem Handy gelöscht und es nicht vermisst. Ich vermisse echte Gespräche. Deswegen logge ich mich dann doch wieder ein, um ein paar sehr kluge und ein paar sehr blöde Ideen in Form von Tweets zu lesen. Nein, Telefonieren mit anderen ist nicht das gleiche, wie sich gegenüber zu sitzen und zu reden. Als ich mich vor einigen Wochen mit einem Freund zum Spazierengehen in einem kleinen Park traf, liefen wir dort mehrere Male im Kreis, wie Ponys auf einer Kirmes. Tierquälerei. Ponys, die ihr Leben damit verbracht haben, mit eng gebundenen Zügeln kleine Zirkel zu laufen, drehen diese Runden sogar weiter, wenn sie irgendwann frei sind.
Ich hasse Twitter gerade und kann nicht ohne. Ich bin wütender, wenn ich dort Zeit verbringe und finde dort 67 verschiedene Themen am Tag, über die ich mich aufregen kann, die mich traurig machen, die mich beschäftigen. Es geht um Schüler_innen ohne WLAN Zuhause, Menschen, die noch immer in Moria und anderen Aufnahmelagern festsitzen, die Klimakatastrophe, Sexismus, Rassismus, das zögerliche Pandemie-Management, die Spotify-Weihnachts-Playlist von Norbert Röttgen, das Gendersternchen und seine Gegner*innen, erschöpfte Eltern, häusliche Gewalt, Rechtsextremismus. Die Themen sind endlos. Es ist alles wichtig und für einen Menschen zu viel. Aber gleichzeitig ist Twitter auch ein Tor zu Welt. Manchmal lache ich so heftig, dass mir das Baby beim Stillen von der Brust fällt. Einige Menschen, die ich über Twitter kennengelernt habe, sind heute Freund_innen von mir, die ich umarme, wenn ich sie sehe. Das interessanteste Pandemie-Gefühl ist für mich das körperliche Verlangen, wenn ich mit Abstand vor einer Freundin stehe und mich kaum beherrschen kann, sie nicht fest zu drücken.
Ich folge auf Twitter auch Menschen, die ich bislang nicht persönlich getroffen haben und zu denen ich dennoch eine Nähe entwickelt habe. Zuneigung. Respekt. Bewunderung. Ich möchte wissen, was sie denken. Mich interessiert, wie es ihnen geht. Sie überzeugen mich manchmal vom Gegenteil. Das ersetzt keine engen Freund_innenschaften und Gespräche, aber wenn man sich gerade nicht sehen kann, dann gibt Twitter einem ein Stück das Alltags zurück, das man vermisst. Das ist nicht erst seit der Pandemie so. Sobald man Kinder hat, lebt man ohnehin mit einer partiellen Ausgangsbeschränkung, weil die eigene Zeit oft an den Ort gebunden ist, an dem das Kind schläft.
Vielleicht liege ich aber auch falsch mit meiner Einschätzung zu Twitter und seiner sozialen und emotionalen Bedeutung. Vielleicht will ich zu viel und konsumiere dort die Gedanken und Meinungen anderer, ohne genau zu wissen weshalb. Muss ich wissen, was 150 Menschen zu etwas denken? Ab wann wird es zu viel? Was wäre ein gutes Maß? Ein Opt-Out ist für mich nicht die Antwort. Es ist kein Ersatz, statt Twitter einfach größere Medien zu nutzen, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören. Nein, das bildet die Vielstimmigkeit nicht ab, das Neue, Unbedachte, Übersehene, das ich über Twitter entdecken kann. Twitter erschöpft mich, aber es hat mich klüger gemacht, selbstkritischer, sensibler. Die Schwarze Autorin Morgan Jerkins hat vor etwa einem Jahr in der taz (Öffnet in neuem Fenster) etwas Wichtiges über Twitter gesagt:
„Wir müssen einsehen, dass nicht alle Menschen auf dieselbe Weise Zugang zu Wissen haben. Und viele Menschen, vor allem People of Color, bilden sich durch das, was auf Twitter geschrieben wird. Twitter baut also Wissenshierarchien ab, die bestimmen, wer als schlau gilt, wer mitreden darf. Ohne Twitter wäre ich heute nicht hier.“
Soziale Medien gefährden die alte Ordnung davon, welche Menschen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Sie haben diese Machtverhältnisse ein Stück weit verändern können. Weniger als notwendig wäre, aber genug dafür, dass sich manche davon bedroht fühlen, dass sie nicht mehr allein bestimmen können, wem zugehört wird und wer sprechen darf. Sie sehen auf Twitter keine Menschen, nur einen ,Mob‘.
Für die deutschsprachige Twittersphäre ist es zudem nicht wahr, dass dort vor allem Menschen mit einem ohnehin hohen kulturellen Kapital schreiben: Journalist_innen, Kulturschaffende, Aktivist_innen, Politiker_innen. Wer sich umschaut (dazu empfehle ich das Hashtag #umsehenlernen (Öffnet in neuem Fenster) von Christiane Frohmann), wird entdecken, dass zum Beispiel Menschen, die in Pflegefachberufen arbeiten, dort eine große und wachsende Community bilden und man über diese Tweets besser informiert sein kann, als lediglich reguläre Berichterstattung zu lesen. Ich habe dort zuletzt viel von der Pflegewissenschaftlerin Martina Hasseler (Öffnet in neuem Fenster) gelernt, von der Medizinhistorikerin Monja Schünemann (Öffnet in neuem Fenster), die lange als Fachkrankenschwester gearbeitet hat und den vielen Fachpfleger_innen, die von ihrer Arbeit auf Intensivstationen oder in Pflegeheimen berichten.
Mit Martina Hasseler, Professorin für Klinische Pflege an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, hatte ich das erste Mal persönlich Kontakt, als ich sie für meine SZ-Magazin-Kolumne „Ist es radikal, Pflegekräften das Gehalt zu verdoppeln?“ (Öffnet in neuem Fenster) interviewt habe. Sie hat nun mich und zwei andere Journalistinnen, die über Gesundheitsthemen berichten, in ihren Podcast „PflegeStandard“ (Öffnet in neuem Fenster)eingeladen, um darüber zu sprechen, wie über Pflegethemen berichtet wird. Am Montag nehmen wir auf.
,Mir fehlen lange, tiefgehende Gespräche so sehr, ich bin kurz davor, einen eigenen Podcast zu starten‘ – das habe ich vor einigen Tagen gedacht und gelacht, weil ein Pandemie-Podcast ein weiteres Projekt ist für Menschen mit zu viel Zeit. Auf der anderen Seite sind Podcasts vielleicht auch Ausdruck der Sehnsucht nach den Gesprächen, die gerade nicht stattfinden können. Dann wenigstens anderen dabei zuzuhören, wie sie gemeinsam in Ruhe Gedanken entwickeln. Podcasts trösten ein wenig über diese Zwischenzeit hinweg, bevor wir uns wieder sehen können, ohne dabei im Kreis rennen zu müssen. Wir werden einfach dasitzen und reden.
In der kommenden Woche werde ich versuchen, meinen ursprünglichen Plan umzusetzen und eine Selfcare- Kritik zu schreiben. Sehr wahrscheinlich kommt es ganz anders. Meine Selbstfürsorge war es zuletzt, Inspirationszitate (Öffnet in neuem Fenster) auf Instagram zu lesen und ich kam mir bescheuert dabei vor, diese eher flachen Inhalte zu teilen, aber in dem Moment tat es mir gut. Tatsächlich versteckt sich in diesen Zitaten ja auch eine kulturelle Veränderung, indem darüber neue Zugänge zu beispielsweise Büchern geschaffen werden und dabei weniger bekannte Autor_innen und andere Persönlichkeiten neue Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe in den letzten Monaten zu viele Fachbücher gelesen, in denen ausschließlich Männer zitiert werden und die Autoren nicht merken, wie unvollständig ihre Analysen damit bleiben. Auch in deutschen Medien kommen mehrheitlich Experten zu Wort. Auf die Berichterstattung über eine Frau kommen im Spiegel neun Artikel über Männer (Öffnet in neuem Fenster).
Während ich mich also mit Zitaten tröstete, weil ich mich leer fühlte, einsam und grau, bin ich auf dieses hier gestoßen von der US-Soziologin, Schriftstellerin und Radikalfeministin Andrea Dworkin:
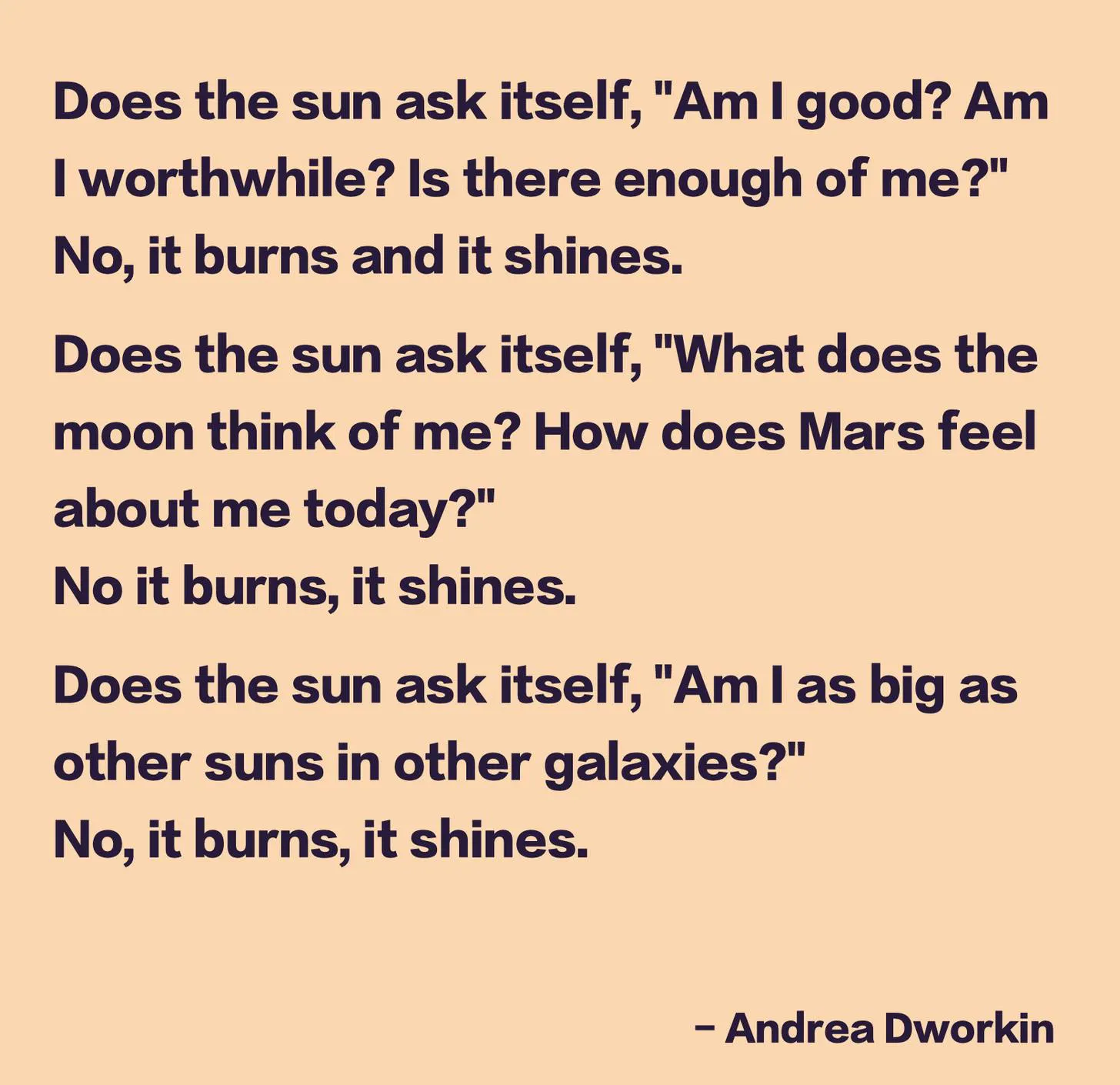
Does the sun ask itself, "Am I good? Am I worthwhile? Is there enough of me?" No, it burns and it shines. Does the sun ask itself, "What does the moon think of me? How does Mars feel about me today?" No it burns, it shines. Does the sun ask itself, "Am I as big as other suns in other galaxies?" No, it burns, it shines.
Es wäre nicht das erste Mal, dass ich in meinem 18. Berliner Winter vergessen hätte, dass die Sonne existiert.
Dieses Zitat hat aber auch eine neue Aufgabe produziert: Texte von Andrea Dworkin lesen und herausfinden, warum sie sich unter anderem so vehement gegen Pornografie und Sexarbeit ausgesprochen hat, da ich selbst eine andere Position habe, als diese Dinge zu verbieten. Da es ihre Bücher vor allem in Antiquariaten gibt und ich sie zunächst besorgen muss, fange ich an mit ihrer Rede von 1983 „I Want a Twenty-Four-Hour Truce During Which There Is No Rape“ (Öffnet in neuem Fenster), diesem Guardian-Text „Why Andrea Dworkin is the radical, visionary feminist we need in our terrible times“ (Öffnet in neuem Fenster) dem Artikel im Jacobin-Mag „The Appeal and Limits of Andrea Dworkin“ (Öffnet in neuem Fenster) und einem Text ihres Partners John Stoltenberg „Andrea Dworkin Was a Trans Ally“ (Öffnet in neuem Fenster).
Burn & Shine
Teresa


