Der große Sommer
Über den Sommer, Sträucher voller Johannisbeeren und das Schwimmen im Attersee, an dessen Ufer vor hundert Jahren mein Ururgroßvater Kastanienbäume pflanzte

Wenn es schon vor dem Abendbrot dunkel wird und der See am Morgen kühler ist als noch vor ein paar Tagen; wenn die Sonne nicht mehr sticht, sondern scheint und sich immer öfter ein paar Wolken überzieht, so wie unsereins die schon fast vergessene Jacke; wenn die Motten die letzte Kastanie zernagt und die Brombeersträucher alles gegeben haben – dann wird es Zeit, die Fahrkarte zu kaufen und die Marmelade zwischen der Wäsche und den gelesenen Büchern im Koffer zu verstauen.
Zu Hause, schreiben die Nachbarn, regnet es. Ein Brief vom Finanzamt liegt in der Post. Und als wäre das noch nicht genug, kriecht einem der Rilke-Wurm durch den Kopf und knarzt: „Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. / Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, / und auf den Fluren laß die Winde los.“
Schon richtig, von einem Herbsttag ist hier die Rede, und so weit sind wir nun wirklich noch nicht. Aber es hilft nichts – das Knarzen geht immer weiter, und bei jedem Blick in den bewölkten Himmel ist der Sommer dahin. Nicht mal ein plötzlich hervorbrechender Sonnenstrahl kann daran etwas ändern.
Es ist wie mit jedem Ohrwurm: Man kriegt ihn so bald nicht los. Und so bleibt einem nichts anderes übrig, als sich der Melancholie von Rilkes Versen zu überlassen. Einer Melancholie, die sofort ins Blut geht – trotz des angestaubten Inventars jener versunkenen Welt, von der sie erzählen. Sonnenuhren hatten schon damals eher musealen als praktischen Wert. Lange Briefe schreibt auch keiner mehr. Immerhin, ein paar Alleen haben überdauert – wo nicht der Fortschritt oder ein anderer Plagegeist sie auf dem Gewissen hat.
Und natürlich gibt es noch den Sommer: groß wie immer, aber anders groß als in der Kindheit, wo er einem unendlich, ja ewig vorkam; eine Verheißung. Das ist er immer noch. Aber jetzt ist er auch noch groß im Anrichten von Unheil, und beim Blick auf all die Hitzewellen, Waldbrände und ausgetrockneten Flüsse fällt einem noch ein anderer Satz von Rilke ein: „Denn das Schöne ist nichts / als des Schrecklichen Anfang“.

Aber bleiben wir bei dem Schönen. Denn herrlich war er natürlich doch: der Sommer, der jetzt dahingeht.
Er begann mit roten Johannisbeeren. Oder sage ich: mit Ribiseln? So nennt man sie in Österreich, der Heimat meiner Frau, wo viele Obst- und Gemüsesorten ganz anders heißen. Zur Aprikose sagt man Marille, zur Pflaume Zwetschke, zur Aubergine Melanzani. Mais ist Kukuruz, grüne Bohnen sind Fisolen und Kartoffeln Erdäpfel. Wunderbar auch das Wort für Tomaten: Paradeiser. Als würde so das Paradies schmecken.
Ribiseln: das kommt vom lateinischen ribes. Eigentlich finde ich Johannisbeeren schöner. In dem o glaubt man die Beere zu sehen: das pralle Rot der kleinen Kugeln, die wie Murmeln davonspringen, wenn sie einem beim Pflücken entwischen. Aber meist sage ich doch Ribiseln. Denn es war in Österreich, wo ich sie vor ein paar Jahren wiederentdeckte.
Als Kind waren sie mir so vertraut gewesen wie Rhabarber und Stachelbeeren, die meine Mutter regelmäßig als Kompott auf den Tisch brachte. Später standen sie nicht mehr so hoch im Kurs. Nach dem Mauerfall gab es auch in Dresden andere Früchte zu kosten und zu bestaunen.
In Österreich begegneten sie mir wieder: Im Land der Mehlspeisen werden sie als Ribiselkuchen mit Schneehaube serviert. Und auch als Marmelade ißt man sie – allerdings nur zum Schnitzel. Weil ich sie auch ohne Schnitzel esse, stockte meine Schwiegermutter die häusliche Produktion auf. Fortan kam ich Jahr für Jahr in den Genuß etlicher Gläser Ribisel-Marmelade. Auf dem Deckel stand ein großes R, und ich konnte mir aussuchen, ob damit die Ribiseln gemeint waren oder ich.
In diesem Jahr nun, an einem heißen Junitag, brachte mir meine Frau aus ihrem neuen Garten ein paar Handvoll mit. Frische rote Johannisbeeren. Sie schmeckten köstlich.
Der Strauch in ihrem Garten war bald abgeerntet. Aber dann führte sie mich zu der kleinen, quietschenden Pforte und zeigte mir das Niemandsland dahinter. Und da gingen mir die Augen über. Denn gleich hinter dem Gartenzaun wucherten die Johannisbeerbüsche, und die waren voll mit reifen roten Früchten.
Offenbar hatte dort jemand vor langer Zeit einen Strauch entsorgt – woraufhin dieser tat, was meine kleine Tochter neulich beim Anblick einiger Rehe in den schönen Satz faßte: „Die genießen ihre Natur.“ Ein Satz, der sich auf erstaunlich viele Situationen anwenden läßt.
An diesem Sommertag genoß ich meine Natur und die Natur der Johannisbeeren, die mir auf geradezu paradiesische Weise fast in den Mund wuchsen.

Und doch wäre der Sommer nicht groß gewesen ohne die Tage am Attersee. Den ganzen langen Winter hatten wir uns darauf gefreut. Und kaum war der Frühling da, ertappten wir uns dabei, wie wir schon mit den Hufen scharrten. Am liebsten wären wir sofort losgefahren. Um es mit Rilke zu sagen: Die Sehnsucht war sehr groß.
Als es endlich soweit war und der See mit seinen im Sonnenlicht glitzernden Wellen vor uns lag, war es wie eine Heimkehr nach langer Zeit. Zugleich fühlte es sich an, als wären wir nie weg gewesen. Der See wogte und schäumte, als wäre er so aufgeregt wie wir.
Doch schon am nächsten Morgen lag er still da: wie ein Tuch, das unsichtbare Hände zwischen den ringsum aufragenden Bergen ausgebreitet haben. Wie immer war ich früh aufgestanden und hinuntergegangen. Kein Mensch war auf der Straße; auf einem Autodach lag zusammengerollt eine Katze und spähte mit schläfrigen Augen zu mir herüber.
Das Wasser war frisch, aber schon nach ein paar Zügen gab es nichts Besseres, als um diese Stunde im See zu schwimmen. Die über dem Berg aufgehende Sonne, das klare Wasser, die Stille – und hin und wieder ein Plätschern, wenn ein Fisch aus dem Wasser sprang.
Nur der See und ich. Mehr brauchte es nicht. Es war das reine Glück.
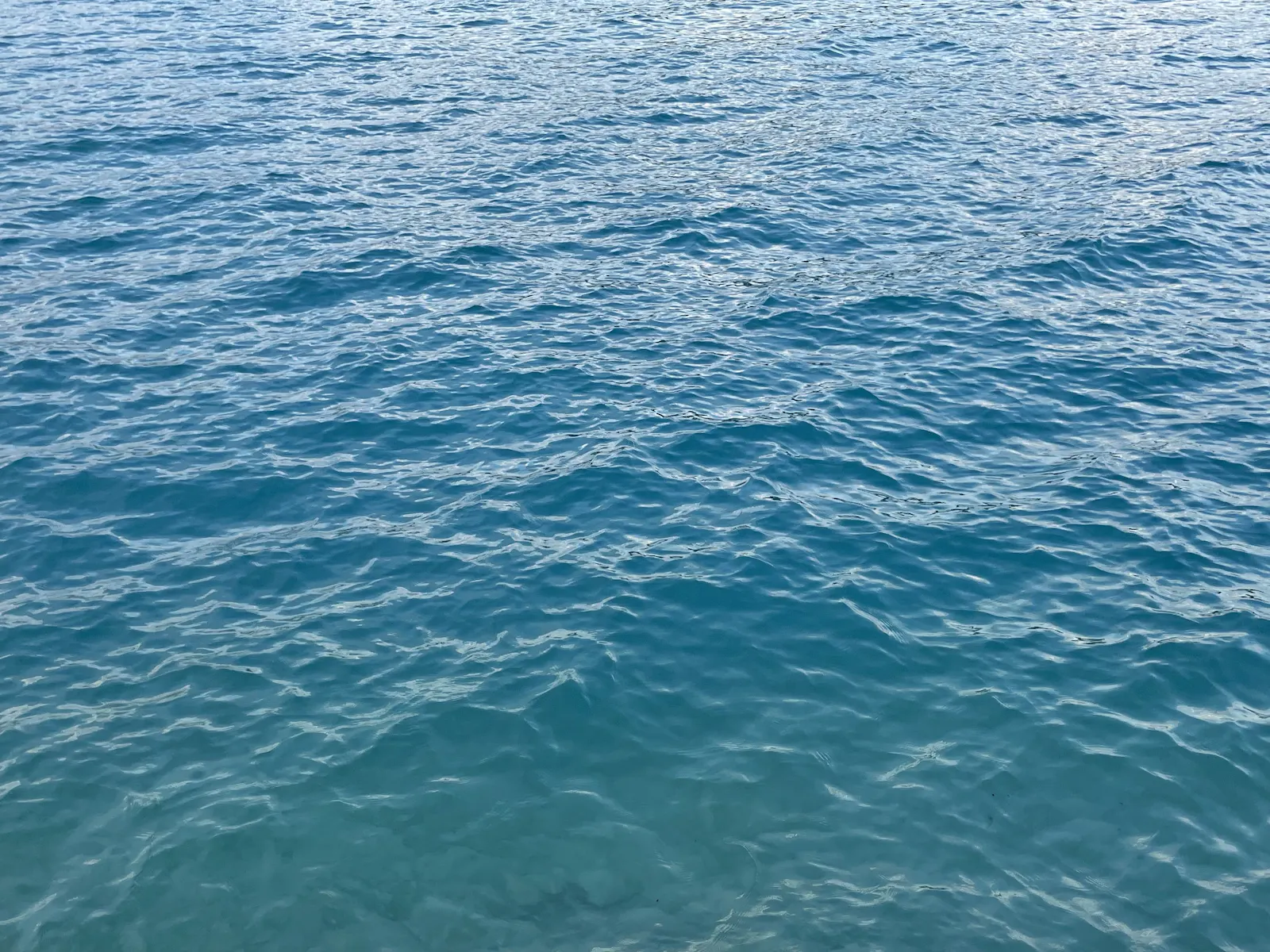
Und warum der Attersee? fragte gestern jemand. Ich fragte zurück: Waren Sie schon einmal da? Er verneinte, und da wußte ich, daß es nicht einfach werden würde, ihm das zu erklären. Er mußte es mit eigenen Augen gesehen haben: die Farbe des Wassers, ein Türkis, wie ich es nur vor Capri gesehen habe, und dahinter das Höllengebirge mit seiner grauen Wucht.
Also erzählte ich ihm von meinem Ururgroßvater, der Wilhelm hieß und den dazu passenden wilhelminischen Bart trug. Ein Wiener Großindustrieller, der die Sommerfrische im Salzkammergut zu schätzen wußte und am Attersee eine Villa erbauen ließ: in Sichtweite zur berühmtesten Villa von Seewalchen, der Villa Paulick, in der einst Gustav Klimt ein- und ausging.
Das Sommerhaus meines Ururgroßvaters gibt es noch – auch wenn es inzwischen etliche Male umgebaut wurde und schon lange nicht mehr im Familienbesitz ist. Von Wilhelm Deckert ist nichts geblieben als eine stattliche Familiengruft auf dem Wiener Zentralfriedhof, über die ich neulich in einer Erzählung über seinen jüngsten Sohn Gustav geschrieben habe: das schwarze Schaf der Familie.
Natürlich erklärt das alles nicht, warum es mich immer wieder zum Attersee hinzieht. Aber ein merkwürdiger Zufall ist es doch, daß ich, in Dresden geboren und hinter Mauer und Stacheldraht lange Zeit völlig abgeschnitten von der Landschaft meiner Vorfahren, hundert Jahre später in dem See schwimme, an dessen Ufer es einmal eine Villa Deckert gab.
Im Dezember 1907 wurde Wilhelm übrigens zum Ehrenbürger von Seewalchen ernannt, weil er die Seepromenade verbreitern und Kastanienbäume pflanzen ließ. Die Bäume gibt es nicht mehr (wie war das mit den Alleen?), aber den See und die Wolken, die jetzt immer mehr werden – wo doch der große Sommer dahin ist.

Diese Geschichte habe ich am 27. August 2022 veröffentlicht. Tragen Sie sich gern hier ein, um weitere Geschichten zu erhalten:
Eine Geschichte wie diese schreibt sich nicht von allein. Um so dankbarer bin ich allen, die mit einer Mitgliedschaft meine freiberufliche Arbeit an „Wolken und Kastanien“ ermöglichen. Das geht schon zum Preis einer Tasse Kaffee im Monat. Wollen auch Sie Unterstützer(in) werden? Das geht hier: