Drug Checking muss sich endlich gegen die falschen Vorstellungen von Drogengebrauch durchsetzen.
Letzte Woche hat mich ein Vorurteil zum Kochen gebracht. Man übt sich ja, ruhig zu bleiben, aber das hat mich erwischt. Ich war in einer Online-Pressekonferenz. Die Referierenden haben Drug Checking als gesundheitspolitische Maßnahme zur Ausweitung in allen Bundesländern empfohlen. Nachdem die Studienergebnisse vorgestellt wurden, die die (erwartet) positiven Effektive auf das Konsumverhalten bestätigen, tat ein anwesender Journalist eines großen Senders seinen Zweifel skeptisch kund, ob das wirklich so sein könne. Drogenkonsumierende, wie er sie vor Augen habe, seien dafür doch “zu unorganisiert”.
Es ist 2025, die Bundesländer werden beim Drug Checking inzwischen seit 2 Jahren nicht mehr von der Bundesgesetzgebung gebremst. Aber nicht nur die Nachfrage des Journalisten, sondern auch die immer noch nur seltenen Drug Checking-Projekte zeigen, dass die Vorurteile und Irrtümer noch dominieren.
Vor 3 Jahren habe ich für den My Brain My Choice-Blog (Abre numa nova janela) bereits einen Artikel über Drug Checking verfasst. Diesen lest ihr heute überarbeitet und aktualisiert.
Es geht nicht darum, Wohlwollen für eine Neuerung zu gewinnen, die den meisten bisher nicht gefehlt hat. Wir müssen als Gesellschaft historische Fehler im Umgang mit Drogengebrauch und Sucht korrigieren.
Um für Drug Checking zu argumentieren, ist es möglicherweise zielführender, sich weniger dafür zu rechtfertigen, warum diese öffentlichen Leistungen ermöglicht und eingeführt werden müssen, sondern zu vermitteln, dass es um die Sicherung von Gesundheitsrechten, also Menschenrechten, geht, die wegen Vorurteilen, Stigmatisierung und Kriminalisierung lange vorenthalten wurden und werden.
Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk ist seit seinem bahnbrechenden Bericht von 2023 (Abre numa nova janela) weiterhin aktiv, das Menschenrechtsproblem des aktuellen politischen Umgangs mit Drogengebrauch und Sucht und die Auswege zu betonen. Letzte Woche zum Beispiel bei Linkedin (Abre numa nova janela). Hier in deutscher Übersetzung:
1️⃣ Integration der International Guidelines on Human Rights and Drug Policy (Abre numa nova janela) in nationale Gesetze
2️⃣ Investitionen in schadensmindernde Maßnahmen
3️⃣ Entkriminalisierung des Drogengebrauchs und Unterstützung der sozialen Wiedereingliederung
4️⃣ Abschaffung der Todesstrafe für Drogendelikte
5️⃣ Verantwortungsvolle legale Regulierung zur Zerschlagung illegaler Märkte, zur Verringerung von Gewalt und zum Schutz der Umwelt
6️⃣ Einbeziehung betroffener Gemeinschaften in die Gestaltung der Drogenpolitik
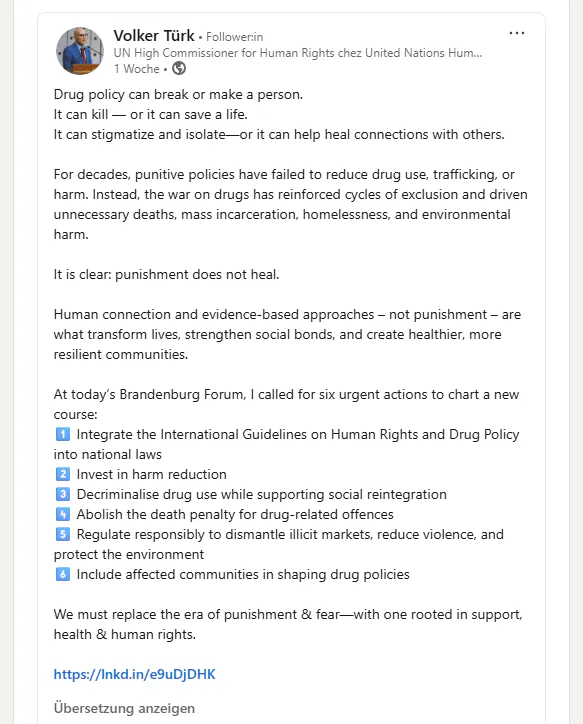 (Abre numa nova janela)
(Abre numa nova janela)Häufige Gegenargumente und Bedenken
„Sicherstellungen durch die Polizei reichen aus, um Daten über den Drogenmarkt zu erhalten und Warnungen herauszugeben.“
Polizeifunde bilden den Markt nicht repräsentativ ab. Es gibt eine zu lange zeitliche Verzögerung, um unmittelbar auf schädliche Substanzen am Markt mit Warnungen reagieren zu können und sie finden, egal mit wie viel Aufwand, immer nur einen Teil davon. Durch ihre Position als Strafverfolger fehlt der Polizei die Glaubwürdigkeit, hilfreiches Wissen zur Reduzierung von Risiken und Schäden vermitteln zu können (was sie auch gar nicht versuchen).
„Drug Checking fördert den Konsum von Drogen.“
Verschiedene kurz- und längerfristige Umfragen haben gezeigt, dass dies nicht der Fall ist. Ebenso wenig wie bei anderen Maßnahmen der Harm Reduction (Abre numa nova janela), zum Beispiel bei Spritzentausch oder Drogenkonsumräumen. Illegale Drogen werden so oder so konsumiert, da es in den meisten Fällen auch unter den illegalen Bedingungen gut genug läuft. Dennoch besteht das Interesse, die gesundheitlichen Risiken zu reduzieren. Es wird durch Drug Checking nicht mehr konsumiert, sondern sicherer und reflektierter (siehe Evaluationen unten).
„Ich fände es besser, wenn man dafür sorgt, dass niemand illegale Drogen nimmt.“
Die Drogengesetzgebungen der Welt zeigen seit 50 Jahren und länger (Abre numa nova janela), dass sich der Gebrauch illegalisierter Drogen selbst durch die drakonischsten Maßnahmen bis hin zur Todesstrafe (Abre numa nova janela) oder gezielten Tötungen der eigenen drogengebrauchenden Bevölkerung (Thailand, 2003; Philippinen seit 2016 (Abre numa nova janela)) geschweige denn Maßnahmen gegen den Handel bspw. in Kolumbien (Abre numa nova janela) nicht verhindern lässt. Das Interesse an den Wirkstoffen ist da und selbst unter den riskanteren illegalen Bedingungen ist der der Drogengebrauch meistens bereichernd und positiv. Ebenso wie bei Alkohol. Die mit Drogen assoziierten Probleme ergeben sich hauptsächlich aus der Illegalität und dem stigmatisierenden Umgang (Abre numa nova janela). Die Risiken und möglichen Schäden lassen sich durch wissenschaftlich fundierte Maßnahmen reduzieren. Beispielsweise die steigenden Zahlen von Todesfällen (Abre numa nova janela) beim oder infolge des Gebrauchs illegalisierter Substanzen sind vermeidbar! Beim Ansatz der Harm Reduction (Abre numa nova janela) (auch: Schadensminderung, Akzeptierende Drogenarbeit) geht es darum, auf Augenhöhe und evidenzbasiert Lebensqualität zu verbessern.
„Senkt das verbindliche Beratungsgespräch von Drug Checking-Projekten wie dem in Berlin nicht die Bereitschaft, das Angebot wahrzunehmen?“
Die beratenden Gespräche findet akzeptierend und bedingungslos statt, also im Sinne einer Dienstleistung für die Person, die das Angebot wahrnimmt. Denn nur so ist es möglich, einen offenen Raum zu schaffen, in der die Person jene Fragen stellt, die für sie zur Reflektion relevant sind. Nur so wird das nötige Vertrauen geschaffen. Die Träger der Projekte bringen durch ihre Tätigkeiten in der Drogen- und Suchthilfe die erforderliche Erfahrung für funktionierende Gespräche ein.
Wie Drug Checking funktioniert
Drug Checking ist meist mit dem Party- und Festivalkontext assoziiert, aber grundsätzlich bezeichnet es einen Service für die Gebrauchenden aller illegalisierter Drogen und funktioniert im Kern so: Konsumierende bringen die illegal erworbenen Substanzen zu mobilen oder stationären Laboren und erfahren im Gespräch mit Fachleuten aus dem Bereich der Drogenhilfe, was in den Substanzen enthalten ist und in welcher Dosis. Die Ergebnisse werden außerdem an Gesundheitsämter und Kliniken übermittelt, die so besser auf Notfälle reagieren können sowie an Initiativen weitergegeben, welche die Pillenwarnungen verbreiten helfen.
1. Die Evaluation von Drug Checking in Berlin beweist, dass es, Überraschung, auch hierzulande erfolgreich ist.
In der Pressemitteilung vom 16.02.2025, (Abre numa nova janela) die den Evaluationsbericht (Abre numa nova janela) (PDF) der Charité zusammenfasst, heißt es:
“Das von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege ins Leben gerufene Berliner Projekt „Analysegestützte Beratung – Drug-Checking“ zeigt Wirkung: Gesundheitsrisiken werden reduziert, das Konsumverhalten hat sich verändert und Menschen mit Substanzkonsum werden niedrigschwellig an Hilfsangebote herangeführt.
Das ist das Ergebnis einer 30-wöchigen Evaluierungsphase der Charité – Universitätsmedizin und des Instituts für Suchtforschung in Frankfurt am Main, die das Berliner Drug-Checking-Projekt wissenschaftlich begleitet haben. Die Evaluierung zeigt, dass das Angebot der Senatsgesundheitsverwaltung auf großes Interesse stößt: Insgesamt nahmen 530 Personen an der Evaluierung teil und reichten insgesamt 1.120 Substanzproben ein. Die Ergebnisse der Probenanalysen verdeutlichen die Bedeutung des Drug-Checkings: Nur 44,8 Prozent der Proben enthielten den erwarteten Wirkstoff, während 53,7 Prozent unerwartete Beimischungen aufwiesen, darunter auch potenziell gefährliche Substanzen. Die analysegestützte Beratung hätte signifikante Auswirkungen auf das Konsumverhalten der Befragten gehabt: Personen, deren Proben unerwartete Stoffe enthielten, verzichteten etwa fünfmal häufiger auf den Konsum. Bei Substanzen mit einer höher als erwarteten Wirkstoffkonzentration wurde die Dosis oft reduziert.
Insgesamt bewerteten 99,4 Prozent der Teilnehmenden das Projekt als nützlich und würden es erneut nutzen. Zudem empfanden 93,8 Prozent die Beratungsgespräche als hilfreich, was die Bedeutung einer kompetenten und niedrigschwelligen Begleitung verdeutlicht. Positiv zu bewerten ist, dass 73 Prozent der Teilnehmenden zuvor keinen Kontakt zum Suchthilfesystem hatten.”
Das Evaluationsergebnis war auch deswegen gut vorhersehbar: Eine Befragung (Abre numa nova janela) unter Partygänger*innen in Berlin hatte vor der Einführung des Projekts ergeben, dass ein sehr großes Interesse an Drug Checking bestand und es ihnen bewusstere Konsumentscheidungen ermöglichen werde.
„The vast majority of participants (92%) stated that they would use drug checking, if existent. If the test revealed the sample to contain a high amount of active ingredient, 91% indicated to take less of the substance than usual. Two-thirds (66%) would discharge the sample if it contained an unexpected/unwanted agent along with the intended substance. If the sample contained only unexpected/unwanted substances and not the intended substance at all, 93% stated to discharge the sample. Additional brief counseling was stated to be useful.“ (Aus dem Abstract; Betzler et al., 2019 (Abre numa nova janela))
Eine andere Begleitstudie ist zum Beispiel diese (Abre numa nova janela) für das Angebot der Drug Checking Initiative The Loop im Vereinigten Königkreich. Es wurden folgende Erkenntnisse gewonnen:
Safer Use-Verhalten wird erlernt und in den Freundeskreis weitergetragen
Die Dosis wird verringert und Abstände zwischen zwei Einnahmen vergrößert, was das Risiko von Überdosierungen reduziert
Substanzen mit schlechter Qualität oder anderen Inhaltsstoffen als erwartet, werden weggeschmissen oder vorsichtiger konsumiert
Weniger Mischkonsum
Nur selten werden infolge von Drug Checking-Ergebnissen höhere Dosen als ursprünglich geplant eingenommen
Weitere Länder mit Drug Checking sind unter anderem (offiziell und informell geduldet):
Österreich, Schweiz, Spanien, Frankreich, Niederlande, Luxemburg, Belgien, Polen, Slowenien, Polen, Portugal, Neuseeland, USA, Uruguay, Kolumbien (bei uns im #MyBrainMyChoice-Blog vorgestellt (Abre numa nova janela)). (Globaler Überblick und Auswertung 2017 (Abre numa nova janela); Europa-Karte vom europäischen Netzwerk TEDI (Abre numa nova janela))
2. Auch benachbarte Regionen profitieren. Allerdings mit Abstrichen.
Drug Checking-Projekte versorgen darüber hinaus überregionale Safer Use-Initiativen mit Pillenwarnungen (z.B. die KnowDrugs App (Abre numa nova janela)). Durch die Entfernung, das heißt, möglicherweise verschiedene Chargen von Lieferungen von Region zu Region, sind die Informationen über die Zusammensetzungen allerdings weniger verlässlich als die konkreten Ergebnisse der abgegebenen Substanz. Ecstasy-Pillen sind selbst bei gleichem Aussehen und aus derselben Charge schon nicht zwingend identisch zusammengesetzt. Bei Stoffen in Pulverform oder bei Pflanzenteilen wird die Aussagekraft von Warnungmeldungen jenseits derselben Party noch schwieriger.
3. Es geht um mehr als Drug Checking.
Wie sich aus der oben zitierten Zusammenfassung der Evaluation herauslesen lässt, geht es beim Drug Checking-Angebot, wie es zum Beispiel in Berlin organisiert wird, auch um den Kontakt zwischen Konsumierenden und Beratungsstellen. In einer Gesellschaft, die Sucht und Probleme mit Drogen stigmatisiert, werden selbst niedrigschwellige, akzeptierende Angebote zu wenig wahrgenommen. Auch wenn man aktuell keinen Bedarf an weitergehender Beratung hat, weiß man zukünftig, wo man für sich selbst oder Angehörige Unterstützung aufsuchen kann und nicht verurteilt oder gegen den eigenen Willen zu etwas genötigt wird.
4. Individuelle Aufklärung
Geht man zum Drug Checking, bekommt man Fragen zu Drogen, Dosis, Set und Setting von Fachleuten beantwortet und muss sich nicht auf Halbwissen aus dem Freundeskreis oder Internet verlassen. Das zwar sehr gut sein kann, aber die Fachleute der Beratungsstellen können einem möglicherweise doch eine ganz gute Hilfe sein, Risiken für seine eigene Situation besser einzuschätzen. Was für die einen im Freundeskreis gut oder schlecht funktioniert, muss nicht auf einen selbst genauso zutreffen.
5. Risiken reduzieren und Gefahren abwenden
Sicherer oder zumindest weit weniger riskanter Drogengebrauch ist möglich. Die einen Substanzen sind zwar schwieriger zu handhaben als andere, aber das heißt nur, dass Verbraucher*innenschutz und die passende Vermittlung von Wissen über Safer Use (Abre numa nova janela) umso wichtiger sind. Ein wichtiges Thema sind dabei zum Beispiel auch die oft unterschätzten oder vielen nicht bekannten Gefahren von einigen Kombinationen bei Mischkonsum, etwa mit Alkohol. Die illegalen Bedingungen erschweren sichere Rahmenbedingungen, aber Drug Checking ist eine Intervention, die in diesem informellen Bereich vermeidbare Risiken abfedert.
6. Die Qualität steigt
Wenn die Endkund*innen schlechte Qualität bei ihren Händler*innen reklamieren, kann dies positive Auswirkungen auf die angebotene Qualität nehmen, wie Umfragen (Abre numa nova janela) nahelegen.
„Participants identified a number of potential impacts that could result in improved supply including being able to select different sources, demand better products, and testing products for sale. Further, as participants noted, drug checking would allow people who sell substances to also seek out better sources and create pressure higher up in the chain. This pressure could help change the way substances are being cut or mixed to result in improved supply.“ (Wallace et al., 2021 (Abre numa nova janela))
7. Dealer*innen sollen vom Drug Checking nicht profitieren, heißt es oft. Dabei ist das eine unterschätzte, ungenutzte Chance!
Das Problem von schädlichen Beimengungen und unklarer Dosis ließe sich weiter reduzieren, wenn Dealer*innen ins Drug Checking involviert werden. An welcher Stelle der Lieferkette die Streckungen stattfinden, ist intransparent, aber es gibt auch initiativ das Interesse von Personen, die in den illegalen Strukturen arbeiten, gute Qualität zu verkaufen: Eine Untersuchung in den USA hat gezeigt, dass Dealer*innen Möglichkeiten zum Drug Checking wahrnehmen, um sicherzugehen, dass sie nicht unwissentlich Fentanyl verkaufen: “I couldn’t live with killing one of my friends or anybody”: A rapid ethnographic study of drug sellers’ use of drug checking (Abre numa nova janela), Betsos et al., 2021)
Dieser Artikel erschien zuerst am 20.5. für die zahlenden Mitglieder (Abre numa nova janela) des Drogenpolitik Briefings, in der Regel erscheint es freitags. Dies hier ist die kostenlose, zeitlich verzögerte Veröffentlichung. Es ist mir wichtig, die Paywall nach ein paar Tagen aufzuheben und ich freue mich über alle Interessierten. Willkommen an die Neuen!
Um dem Schreiben der Kommentare und Kritiken mehr Zeit einräumen zu können, suche ich weitere Unterstützer*innen. Aktuell hat das Briefing 21 zahlende Förder*innen, die mir mit insgesamt 252 Euro im Monat helfen, diese Aufklärungsarbeit zu leisten.
Ich weiß euch alle als Leser*innen zu schätzen. Weiterempfehlungen sind ebenfalls eine große Hilfe, um diesem Briefing zu Reichweite zu verhelfen!
Wer diesen Artikel im Web entdeckt oder weitergeleitet bekommen hat und noch nicht als Newsletter ins E-Mail-Postfach erhält, kann das Drogenpolitik Briefing hier:
Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt öffentlich unter den Beitrag (in der Webansicht), mir an pe@mybrainmychoice.de (Abre numa nova janela) oder antwortet auf diese Mail.
Beste Grüße aus Berlin
Philine


