Die Zukunft der Erinnerungsarbeit
4.5.2025: Wir sprechen oft darüber, wie wir eine junge Generation in Zukunft für Erinnerungsarbeit gewinnen können. Aber wir müssen auch über diese Zukunft sprechen.
In Dachau finden aktuell die Gedenkfeierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Befreiung statt. Teil dieser Gedenkfeierlichkeiten war auch das 1. Forum der Nachkommen, bei dem am 2. Mai 2025 in einem Zelt auf dem Gedenkstättengelände Überlebende sowie Angehörige derer gekommen waren, die durch das NS-Regime ermordet wurden. So vielfältig wie die Menschen, die im KZ Dachau die Hölle erlebt haben, so vielfältig sind auch die Geschichten der Angehörigen. Ihre Sprachen, ihre Herkünfte.
In drei Sprachen wurde auf der Bühne des Forums gesprochen: Deutsch, französisch und englisch. Das ist viel und gleichzeitig wenig. Denn im KZ Dachau waren Menschen aus 40 Nationen inhaftiert, auch russische Kriegsgefangene und polnische Zwangsarbeiter. Die Übersetzung in mindestens eine osteuropäische Sprache wäre wünschenwert gewesen. Aber es war auch das erste Mal, dass so ein Forum der Nachkommen in Dachau stattfand. Da muss auch noch Raum bleiben für Steigerung bei den nächsten Veranstaltungen dieser Art.
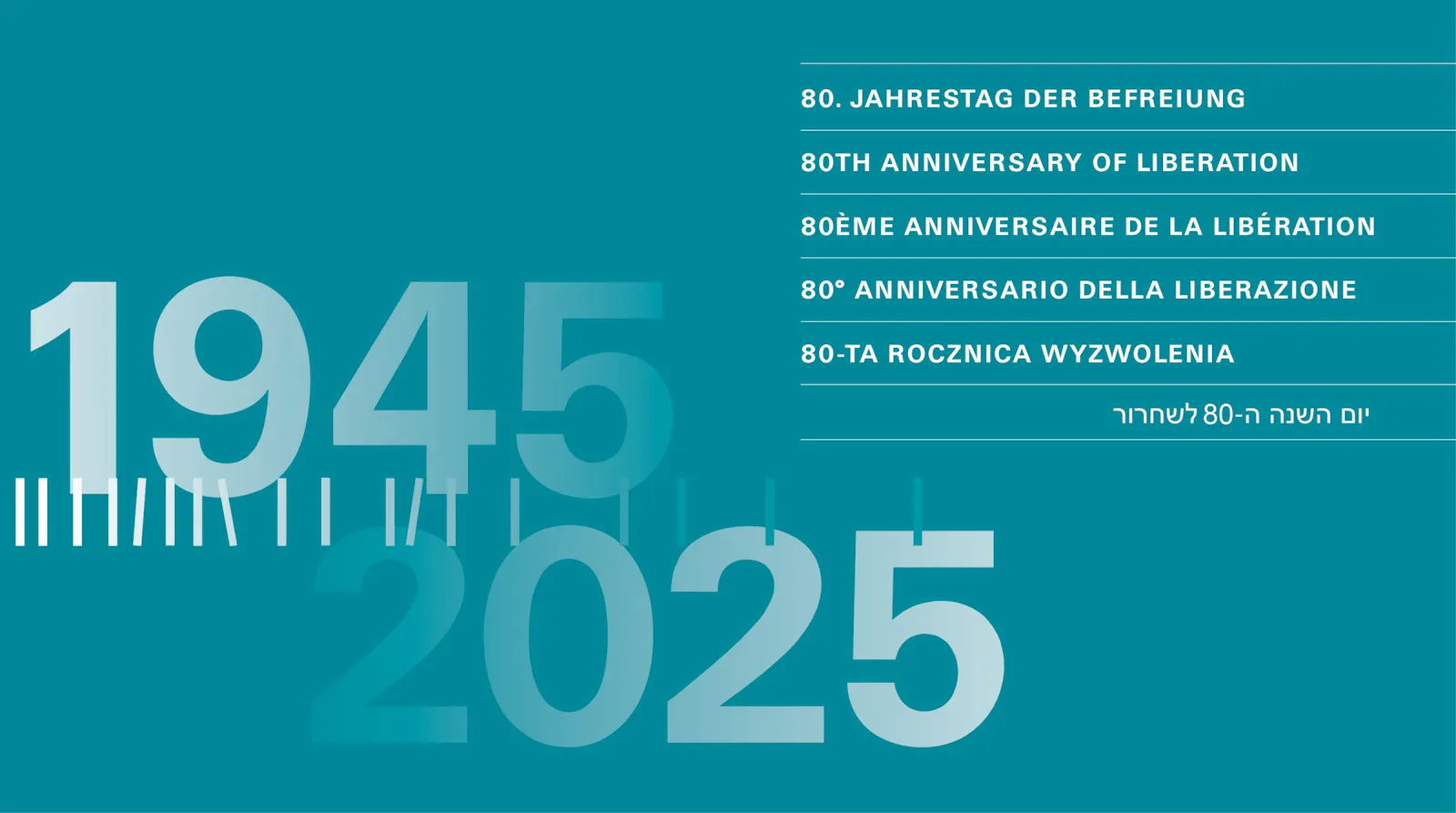
Vernetzung der Nachkommen
Es war ein Forum der Vernetzung über Länder und Vereinigungen hinweg. Ein Forum, auf dem Menschen aus unterschiedlichen Nationen mit unterschiedlichen Geschichten auch über das Ende des NS-Terrors und des Zweiten Weltkriegs hinaus sich austauschen können über ihre Erfahrungen und die Erinnerungsarbeit in den jeweiligen Ländern.
Und genau dazu gab es auch ein dreisprachiges Panel, das ich moderieren durfte. Details aus dem Panel - so haben wir es verabredet - werden nicht veröffentlicht. Damit sich alle sicher und wohl fühlen können, offen zu sprechen. Aber einen Gedanken möchte ich gerne mit euch teilen:
Wie sieht unsere Zukunft aus?
Denn neben vielen anderen Themen haben wir uns auch eine ganz entscheidende Frage gestellt: Von welcher Zukunft sprechen wir eigentlich, wenn wir von der “Zukunft des Erinners” sprechen? Wie sieht diese Zukunft eigentlich aus? Welche Aufgaben kommen Gedenkstätten dabei zu und den verschiedenen Akteur*innen in der Erinnerungsarbeit? Die Frage nach der Zukunft ist dabei ganz entscheidend. Denn wir merken schon jetzt, dass diese Zukunft anders aussehen wird, als wir das bislang angenommen haben.
Wir müssen uns schon jetzt damit beschäftigen, wie wir Erinnerung - und damit meine ich zB auch Dokumente - überhaupt bewahren und beschützen können vor zunehmender politischer Instrumentalisierung, geschichtsrevisionistischem Missbrauch und möglicherweise auch Vernichtung. Das klingt vielleicht übertrieben. Aber wir sehen in den USA zahlreiche Versuche (Abre numa nova janela), bestimmte Menschen aus der Geschichte zu eliminieren (Abre numa nova janela). Wie zB Schwarze Menschen, Frauen, PoC, Indigene, queere und trans Menschen.
Ihre Geschichten werden von Websites gelöscht (Abre numa nova janela), in Museen verhängt oder gleich ganz abgebaut. Und auch aus Archiven verschwinden Digitalisate, Studien, werden Bücher und Forschungsprojekte verbannt oder gelöscht. (Abre numa nova janela) Und so dystopisch das klingt: Das ist gerade die Realität in den USA. Und zahlreiche Initiativen sind damit beschäftigt, diese Daten zu retten, bevor sie unwiederbringlich verloren sind.
Gedenkstätten müssen unabhängig arbeiten können
Vor diesem Hintergrund ist es nicht übertrieben zu fordern, dass Gedenkstätten nachhaltig finanziert werden und unabhängig arbeiten können müssen. Das ist nichtmal eine Frage für die Zukunft, das ist eine Frage der Gegenwart. Auch hierzulande gibt es bereits Gedenkorte, die um ihr Überleben kämpfen, wie zum Beispiel in Sachsen die KZ Gedenkstätte Sachsenburg (Abre numa nova janela) - übrigens die einzige KZ-Gedenkstätte in Sachsen (Abre numa nova janela). Und nein, das liegt nicht daran, dass hier die AfD das Sagen hätte: “Die neue Landesregierung aus CDU und SPD will die Arbeiten über die begonnenen Bau- und Geländesicherungsmaßnahmen hinaus nicht fortsetzen. Die Mittel im Haushalt 25/26 sind auf null gesetzt.” heißt es im Artikel der “Sächsischen Zeitung” (€). Und nicht nur diese KZ Gedenkstätte in Sachsen ist gefährdet. Im Prinzip trifft die Nullrunde im Landeshaushalt alle Projekte der Stiftung Sächsische Gedenkstätten.
Die Unabhängigkeit der Gedenkstätten ist aber auch dadurch gefährdet, dass in der aktuellen Weltlage viele Akteure versuchen, diese Orte bei ihren Besuchen politisch zu instrumentalisieren. Auch das ist natürlich nicht neu. Aber wir befinden uns in einer Welt, in der die Lüge so salonfähig ist wie selten. Wo faschistische Regime Geschichtsrevisionismus betreiben - und das ausgerechnet an den Orten, die geschehenes Unrecht erforschen, bezeugen, bewahren und in die Zukunft tragen wollen. Gedenkstätten sind per se politische Orte. Sie haben eine Aufgabe.
Wenn sie aber damit konfrontiert sind, dass sie aus staatspolitischen und diplomatischen Gründen plötzlich Politiker*innen als Kulisse dienen (Abre numa nova janela) müssen, die Kriege gegen ihre Nachbarländer führen oder auf offener Straße Menschen ohne jedes Gerichtsurteil verhaften, wegsperren, ausweisen oder in Gefangenenlager ins Ausland verschleppen, dann muss schon die Frage erlaubt sein, ob das so sein soll. Wenn Regierungen plötzlichlich bestimmen können (Abre numa nova janela), wer auf einer Gedenkfeier reden darf und wer nicht, weil die politische Haltung nicht genehm ist und die Menschen dann ausgeladen werden, um diplomatische Verwerfungen zu verhinden, dann muss die Frage erlaubt sein, ob ausgerechnet Gedenkfeiern der richtige Ort sind, solche diplomatischen Fehden auszutragen.
Bildungs- und Begegnungsorte
Ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass Gedenkstätten mehr sind als Bildungsorte. Sie sind aber immer mehr auch Orte, an denen Überlebende, Opfer-Angehörige und deren Nachfahren sich begegnen. Sie sind Orte der Recherche und auch heute noch helfen Mitarbeiter*innen von Gedenkstätten dabei, Familiengeschichten aufzuklären. Denn längst nicht jedes Schicksal ist geklärt und auch über 90 Jahre später suchen Familien nach verschollenen Angehörigen, wollen wissen, welches Schicksal sie erleiden mussten.
Gedenkstätten sind Ankerpunkte für internationale Vernetzung - und sie sind vor allem schützenswerte Bewahrer von Wissen und Dokumenten. Dass wir Archive so nutzen können, wie wir das gerade tun, ist keine Selbstverständlichkeit. Wir brauchen also dringend nicht nur Gespräche darüber, wie wir kommende Generationen für die Geschichte interessieren. Sondern wie es uns überhaupt gelingt, die Dokumente zu bewahren, die von dieser Geschichte erzählen.
P.S. Auch andere Gedenk- und Aufarbeitungsorte sind gerade akut in Gefahr, die sich nicht mit NS-Geschichte, dafür aber mit der Aufarbeitung der DDR-Geschichte beschäftigen: In Chemnitz steht der Lern- und Gedenkort Kaßberg (Abre numa nova janela) vor dem Aus, der erst vor 1,5 Jahren eingerichtet und eröffnet wurde. Falls ihr die Einrichtung finanziell unterstützen wollt, könnt ihr diesem Link folgen (Abre numa nova janela).
Dir hat dieser Newsletter gefallen? Dann freue ich mich, wenn du ihn mit anderen teilst. Noch nicht abonniert? Dann einfach den Button oben klicken. Der Newsletter ist kostenlos. ⬆️


