S(i)eems GREAT to me: Meine Tipps für Sie (Nr. 1/23)
Die Krokusse stehen kerzengerade im Beet, die Sonne wurde trotz Energiekrise ein paar Grad wärmer gestellt und, war das etwa Kohlequalm vom Grill nebenan? Nö, bloß eine Vape-Wolke mit BBQ-Aroma. Egal, es ist endlich eine Art spring time, auch in meiner norddeutschen Heimat, und damit Zeit für ein wenig Frühjahrsputz in der Linkliste. Ein paar Perlen teile ich hier mit Ihnen. Viel Vergnügen!

Das Büffet ist eröffnet! So jedenfalls verstehe ich diesen Bonus-Newsletter für Sie, liebe Abonnenten. Ein kunterbunt-köstliches Potpourri aus Empfehlungen – vom Kulturgenuss über food for thought bis zum Konsumgut. Sie haben Ideen für mich und die Community? Schreiben Sie mir an: luxusprobleme@luckyincmedia.com (Öffnet in neuem Fenster). Und jetzt viel Spaß beim Stöbern durch mein März-Sammelsurium. Wir lesen uns am 12. April wieder. Toll, dass Sie dabei sind!
Bleiben Sie gesund und neugierig – Ihr Siems Luckwaldt
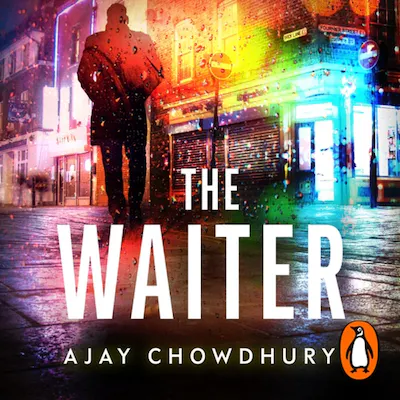
Kopfkino
Seit ich „Slumdog Millionaire (Öffnet in neuem Fenster)“ und später „Life of Pi (Öffnet in neuem Fenster)“ im Kino gesehen habe – in beiden Fällen eine emotionale Achterbahnfahrt durch berauschende Bilder, begleitet von berührenden Protagonisten – bin ich fasziniert von indischer (Pop-)Kultur. Kein Kenner, mitnichten, wohl aber ein Fan aus der Ferne. So verfolgte ich vor einiger Zeit gebannt den Polizisten Sartaj Singh durch Mumbais Unterwelt in dem Neo-Noir (Öffnet in neuem Fenster)-Thriller „Sacred Games (Öffnet in neuem Fenster)“ (auf Netflix) nach einer Romanvorlage von Vikram Chandra (Öffnet in neuem Fenster). Ein atmosphärisch dichtes Highlight mit perfekt im tödlichen Geschehen platziertem (Galgen-)Humor und viel Wissenswertem zu hinduistischen Überzeugungen und Traditionen.
Mitten in London wiederum, jedoch vor dem Hintergrund seiner indischen Herkunft, spielt mein eigentlicher Lese- und Hörtipp: die Krimireihe um den Erst-Cop-jetzt-Kellner Kamil Rahman von Autor Ajay Chowdhury (Öffnet in neuem Fenster). Gleich im ersten Band, „The Waiter (Öffnet in neuem Fenster)“ (erschienen bei Penguin), endet eine Party, auf der Kamil Snacks serviert, mit einem Toten im Pool. Der Verdacht fällt auf die junge trophy wife des Opfers und bald wird der junge Ex-Ermittler ungewollt in die Ermittlungen verwickelt. Ein Fall, der in Kamil Erinnerungen an den Grund aufwühlt, weshalb er seine Heimat Kalkutta einst bei Nacht und Nebel verlassen musste.
Als Thriller-Junkie war ich weniger vom Spannungsgrad der Handlung von „The Waiter“ begeistert als vom sympathischen wie vielschichtigen Protagonisten, der mal kein hard-boiled (white) detective mit Alkoholproblem war oder eine überspannte Marketing-Managerin in Manhattan, die im Nachbarhaus ein Pärchen bespitzelt und es bei einem Mord beobachtet zu haben glaubt. Kamil führt kein glamouröses Leben, er gehört zu einer Minderheit in seinem selbstgewählten Exil und kämpft mit der traumatischen Vergangenheit ebenso wie mit den Regeln seiner Kultur und den Lügen des übrigen Roman-Ensembles. Eine sehr lesbare, wichtige Ergänzung für das mitunter arg ausgelatschte Genre. Übrigens ist „The Waiter“ auch und gerade als Hörbuch (Öffnet in neuem Fenster) ein Genuss, weil der Vorleser, Schauspieler Mikhail Sen (Öffnet in neuem Fenster), selbst in Bangalore, Delhi und Mumbai aufwuchs und nun in England lebt. Ein famoser fit!

Wohlklang
„I wanna believe in everything that you say
'Cause it sounds so good“
– „Sometimes“
Statt von diesem grandiosen Cover eines Britney-Spears-Songs durch die queere Indieband MUNA (Öffnet in neuem Fenster) zu schwärmen, könnte ich hier Bildschirmseiten mit Applaus für den Film füllen, auf dessen Soundtrack jenes Pop-Kleinod zu finden ist: „Fire Island“. Diese romantische Kömodie, geschrieben von und mit US-Comedian Joel Kim Booster (Öffnet in neuem Fenster) in einer Hauptrolle (Regie: Andrew Ahn (Öffnet in neuem Fenster)), ist so, wie ich mir früher schwules Kino gewünscht hätte, als ich in einem reichlich trostlosen Hamburger Randviertel aufwuchs. Eine idyllische Location, im titelgebenden LGBT-Ferienmekka am Südzipfel, Pardon, von Long Island. Eine Gruppe enger, ähem, Freunde, die einander fordern, fördern und verstehen. Authentische Gespräche, realistisches Flirten, ein Lebens- und, ja, Sex-bejahender vibe.
Dazu mitreißende Musik wie eben „Sometimes (Öffnet in neuem Fenster)“, in einer Sommer-Sonne-Herzschmerz-Eiscreme-Version von den MUNA-Mädels. Da wird aus dem Hit von Miss Spears anno 1999 und der, aus heutiger Sicht, problematischen Lolita-Ästhetik des Videos, plötzlich ein selbstbewusstes Zuneigungs-Statement samt angenehm modernisiertem Festival-Sound. Und wer auf den Geschmack gekommen ist, sollte nicht nur „Fire Island“ und Joel Kim Boosters Netflix-Special „Psychosexual (Öffnet in neuem Fenster)“ gucken, am besten mit einem Cocktail auf dem Couchtisch, sondern gleich noch „I Know A Place (Öffnet in neuem Fenster)“ auf die Playlist setzen. Ein weiterer MUNA-Anspieltipp.

Gaumenschmaus
Laut der Vivino-App, mit der ich beim Rewe ewig Etiketten im Regal scanne, um das globale Publikum nach einer trinkbaren Flasche Wein zu fragen, habe ich es mit um die 130 bewerteten Tropfen immerhin auf Rang 6700 aller User geschafft. In Deutschland. Na ja. Bin ich ein Verkostungsprofi, der jede Steilhanglage auf zehn Meter wittert und nur mit von Tanninen gegerbtem Gaumen glücklich ist? Nope, ich werde wohl immer ein Gourmeggle (Öffnet in neuem Fenster) bleiben, ein interessierter Laie mit kulinarischer Klappentextbildung. Macht nichts, mit 45 Jahren entwachse ich so langsam dem Alter, in dem man noch mit krampfhaftem Ehrgeiz versucht, zu den cool kids zu gehören.
Was nicht heißt, dass ich den Sauvignon Blanc von Cloudy Bay (Öffnet in neuem Fenster) verschmähe, der mir einmal im Jahr zum Preis einer halben Tankfüllung die Zunge mit Maracuja- und Litschinoten flutet. Bedeutet aber auch, dass ich die Der-geht-immer-Qualitäten des „Red Winemaker's Blend (Öffnet in neuem Fenster)“ von Apothic (Öffnet in neuem Fenster) unbedingt zu schätzen weiß. Ein tiefdunkler Kalifornier aus Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon und Zinfandel, der bisher auch den größten Traubenmuffeln an unserem Wohnzimmertisch gemundet hat. Was am unwiderstehlichen Mix aus Vanille, Eiche, Brombeere, Kirsche und Schokolade liegen mag. „Wuchtbrumme“ heißt es in einer Bewertung, und diesem herrlich unorthodoxen Kommentar schließe ich mich gern an. Wie sagte mir eine Kollegin einmal, die jahrelang die Weinproben für „Der Feinschmecker“ organisiert hat: „Wein muss dir schon schmecken, schönreden allein reicht nicht.“ Also, cheers!

Bewegtbild
Ich muss dringend mal nach Seoul! Denke ich seit Wochen, vor allem abends oder im Zug, wenn auf dem iPad eine Folge irgendeiner koreanischen Serie läuft. Jep, während sich die tracks der Milliarden-Band BTS für mich leider nur ansatzweise in Ohrwürmer verwandeln, hat mich das Fernsehen „von dort“ komplett im Griff. Nicht jedes K-Drama, klar, ich bleibe meist den Spannungsformaten treu. Aber hat man sich einmal eingeguckt – und an den unfassbar perfekten, porenlosen Teint der Darsteller gewöhnt – dann finden sich gerade auf Netflix viele Serien, die meiner Meinung nach das Prädikat „Weltklasse“ verdienen. Und die so gar nichts mit Schöpfungen wie „Squid Game (Öffnet in neuem Fenster)“ zu tun haben, die man zu Recht ambivalent sehen sollte: als hoch originell und hochproblematisch ob der zelebrierten Brutalität.
Beispielhaft möchte ich hier „The Glory (Öffnet in neuem Fenster)“ erwähnen, einen fesselnden Psychothriller um eine Frau, die nach knapp 20 Jahren ausgeklügelt Rache nimmt an der grausamen Clique, die sie zu Schulzeiten schwer misshandelt hat. Bis in die letzte Rolle exzellent besetzt, schafft es das von der Kritik gefeierte Drama, allen Charakteren ein Eigenleben von adäquater Komplexität zu verleihen und selbst den übelsten Figuren etwas Mitgefühl entgegenzubringen. Tragende Säule ist Song Hye-kyo (Öffnet in neuem Fenster) als „Moon Dong-eun“, die an der Aufgabe, ihre Peiniger zu bestrafen, keine diebische Freude hat, sondern darin den letzten Akt ihrer irdischen Existenz sieht. Die Kamera bleibt jeder Nuance ihres reduzierten Spiels nah, wir blicken fast durch ihre Augen auf das sich rasch zuspitzende Geschehen. Denn die Rückkehr in ihre Heimatstadt bringt mehr und mehr Dominos zum Kippen, mit fatalen Folgen. Erwähnen will ich außerdem Lim Jo-yeon (Öffnet in neuem Fenster) als „Park Yeon-jin“, eine TV-Wetterfee und Initiatorin der Quälereie von damals. Ein packender Fernsehabend, Folge für Folge.
Ihnen hat „The Glory“ gefallen und Sie wollen mehr vom gleichen Schlag? Gern. Umgehauen haben mich beispielsweise die psychologische Authentizität und unfassbar symbiotische Chemie der Hauptdarsteller von „Flower of Evil (Öffnet in neuem Fenster)“ (Taschentücher bereithalten!), das bitterböse Katz & Maus-Spiel in „Beyond Evil (Öffnet in neuem Fenster)“, die koreanische (und bessere) „Mindhunter (Öffnet in neuem Fenster)“-Variante „Through the Darkness (Öffnet in neuem Fenster)“, das raue Eine-Frau-kämpf-sich-durch-Spektakel „My Name (Öffnet in neuem Fenster)“, der schräge Horror-Spaß „Strangers from Hell (Öffnet in neuem Fenster)“ – und die hinreißende BDSM-Büro-Komödie „Love and Leashes“ (Öffnet in neuem Fenster). Ich bin gespannt auf Ihr Feedback und Ihre TV-Tipps!
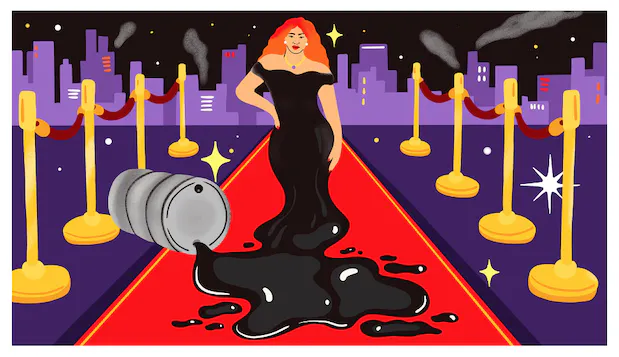
Denkanregung
Die Oscars sind verliehen und ich habe mich zum Sinn und Unsinn eines roten oder beigefarbenen Teppichs bereits auf profashionals (Öffnet in neuem Fenster) geäußert. Im „Hollywood Reporter“ hat sich Journalistin und Autorin Dana Thomas (Öffnet in neuem Fenster) (Buch: „Fashionopolis: Why What We Wear Matters (Öffnet in neuem Fenster)“, Podcast: „The Green Dream (Öffnet in neuem Fenster)“) derweil ihre Gedanken darüber gemacht, wie weit Stars und Sternchen auf der Reise zur grünen Gala-Garderobe bereits gekommen sind. Oder auch nicht, wie die Illustration von Sol Cotti (Öffnet in neuem Fenster) nahelegt. Es gibt noch viel zu tun, im Blitzlichtgewitter und in dessen Schatten. Den Beitrag, Teil der jährlichen „Sustainability Issue“ des Branchenblattes, finden Sie hier (Öffnet in neuem Fenster).
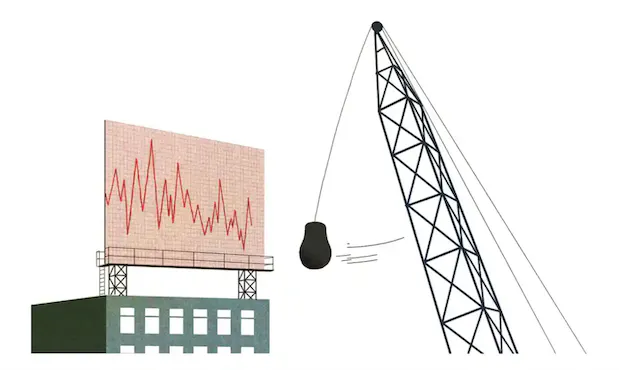
Illustration: Michael Kirkham / The Guardian
Ich habe zwar kein BWL-Studium absolviert, schon gar nicht auf einer Elite-Uni, die unsere Chefs von morgen auszubilden verspricht. Und sich das fürstlich entlohnen lässt. Doch nach über 20 Jahren als Teil von Wirtschaftsmedien wie der „Financial Times Deutschland“ oder „Capital (Öffnet in neuem Fenster)“ sind eine Menge an Markt-Prinzipien, wirtschaftlichen Glaubenssätzen und Boss-Bonmots in mein Hirn diffundiert, und ich interessiere mich sehr für das, was wir Big Business nennen. Dazu gehört ein grundsätzliches Stirnrunzeln gegenüber der Performance all jener Überflieger, die solche sündhaft teuren Institutionen absolvieren und auf Mitarbeiter losgelassen werden. Oder auf Beratungskunden, wie bei McKinsey (Öffnet in neuem Fenster).
Bereits 2018 schrieb Martin Parker im „The Guardian (Öffnet in neuem Fenster)“ auf, warum man für die weltweit rund 13.000 Business Schools ruhig die Abrissbirne rufen könnte. Pikant: Parker hat 20 Jahre lang an ebenjenen Management-Schmieden unterrichtet. Sein Gegenvorschlag für Einrichtungen, die einzig für den Markt ausbilden: „Schulen für Organisation“, die Studenten befähigen, sich auf eine verändernde Welt voller Herausforderungen bzgl. Ungleichheit und Klimawandel einzustellen. Statt ihnen bloß neoliberale (Öffnet in neuem Fenster) Dogmen einzutrichtern. Hm?!

Kaufanreiz
Nun zu einem echten Luxusproblem. Dazu muss ich kurz ausholen: Wie einige von Ihnen vielleicht wissen, schreibe ich seit vielen Jahren über (meist kostspielige) Uhren, habe mir den Capital Watch Award (Öffnet in neuem Fenster) ausgedacht und packe gerade meinen Koffer für die weltgrößte Uhrenmesse Watches & Wonders (Öffnet in neuem Fenster) in Genf. Eine ungemein spannende Branche, voller außergewöhnlicher Persönlichkeiten und mit zugleich archaischen und wie hypermodernen Produkten. Wie viele meiner Kollegen werde auch ich so das Privileg haben, Zeitmesser für Zehntausende Euros am eigenen Handgelenk bewundern und diese Momente als Instagram-Foto festhalten zu dürfen.
Und wieder wird es ein Schaulaufen jener Reporter geben, die selbst bereits eine kleine Uhrensammlung zusammengetragen haben und die neuesten Stücke daraus nach Tageslaune unter der Hemdmanschette hervorblitzen lassen. Das männliche Pendant zur Trendhandtasche bei den Modewochen in Mailand oder Paris, die sich Redaktionsassistentinnen meinen, vom Überziehungsbudget ihrer Kreditkarte kaufen zu müssen. Peer pressure nennt man das wohl.
Nun wurde mir das Interesse für Tourbillon, Keramiklünette und Siliziumspirale weder in die Wiege gelegt, noch gab es die „Uhr zum Abitur“ geschweige denn die Chance, Papas Rolex zu erben. Mangels Rolex im Familienbesitz. Und ganz gleich wie sehr ich mich in den letzten 25 Jahren im Job angestrengt habe, in Festanstellung, als freier Autor oder im jetzigen Hybrid aus beidem, nie war auf meinem Girokonto so viel übrig, dass es für eine „ordentliche“ Uhr gereicht hätte. Schon gar nicht für eines der Modelle mit Investment-Status, über die ich so oft schreibe.
Wenn die hohe Kante für größere Anschaffungen ausreichte, waren meist andere Dinge wichtiger: neue Fenster für unser altes Haus, eine Autoreparatur, ein dringend nötiger Erholungsurlaub ... Meine Prioritäten waren seltenst Richtung Prestige ausgerichtet, und die Mär vom Gay-Haushalt mit zwei Einkommen ohne Kinder ist genau das: ein albernes Klischee. Keinen Schimmer, wie andere Medienmacher zu ihrem tickenden Armschmuck kommen. Vermutlich können die besser mit Geld umgehen, als ich. Denn wenn ich von Zahlen wirklich Ahnung hätte, wäre ich kaum Journalist geworden.
Anyhow, nach langer Suche habe ich nun im Rahmen meiner Möglichkeiten gekauft und bin so happy wie stolz darüber (s. oben). Stimmt, nichts zum Angeben. Keine Uhr, die man für Generationen aufhebt, mit der im Nightlife gepunktet wird oder die neidvolle Blicke auf sich zieht. Vermutlich eher Mitleid. Mir alles wurscht. Ich mag meine neue Seiko SRPE51 (Öffnet in neuem Fenster) aus der „5 Sports“-Kollektion und behandle sie mit der gleichen Vorsicht wie eine Grand Complication bei einer Magazin-Fotoproduktion. Lebe das Leben, das DU dir leisten kannst. Ein Motto, das deutlich weniger sexy klingt als der (gepumpte) Lifestyle (Öffnet in neuem Fenster) vieler Social-Media-Größen. Aber, ich sagte es bereits, für sich selbst belügende Augenwischerei bin ich schlicht zu alt.
Zwerchfellkrampf
„Ich habe mich gerade im Bus neben ein sehr hübsches Mädchen gesetzt. Wir haben sogar geredet. Sie so: Kann ich mal raus? Ich so: Okay.“
(gefunden auf business-punk.com (Öffnet in neuem Fenster))

Quittung
Extra-Trinkgeld: Herzlich willkommen in der „Sesamstraße“, liebe Elin (Öffnet in neuem Fenster). Erstaunlich eigentlich, dass es bisher keine Puppe mit offensichtlicher Behinderung in der Crew des Kinderklassikers gab. Schließlich weiß man aus der Psycho- und Soziologie, wie wichtig es ist, sich und die eigene Wirklichkeit auf dem Bildschirm repräsentiert zu sehen. Inklusion braucht Sichtbarkeit. Dafür zahle ich als ehemaliger Zivi in einer Töpferei für Menschen mit (diversen) Behinderungen gern GEZ-Gebühren. Und für Böhmermann (Öffnet in neuem Fenster), natürlich.
1 Stern bei Yelp: Elon Musk. Wie der Tesla- und Twitter-Crasher zu seinen wirren Ansichten über Hightech, Geschäft und Gesellschaft kam, ergründet die preisgekrönte Journalistin Jill Lepore (Öffnet in neuem Fenster) in ihrem neuen Podcast „Elon Musk: The Evening Rocket (Öffnet in neuem Fenster)“. Spoiler: Der Extremkapitalist ist eigentlich nie über die Science-Fiction-Romane seiner Jugend hinausgewachsen. Hätte man sich denken können. Piep, piep, kleiner Satellit (Öffnet in neuem Fenster) ...

Bild, schön!
Ehe unser Hund (Öffnet in neuem Fenster) sich zu einem Porträt überreden oder bestechen lässt, dauert es noch etwas. Sie will nämlich unbedingt zum Fellstutzen, ehe sie ready for her close-up (Öffnet in neuem Fenster) ist. Also muss diesmal eine Öl-Landschaft herhalten, die ich zufällig bei einer Bildrecherche fand. Die Malerin hat etliche ihrer nett-naiven Motive ins Netz gestellt, die mich vor allem wegen ihres sehr plastischen Farbauftrages – zu sehen auf dem hochaufgelösten Bild (Öffnet in neuem Fenster) – begeistern.
Über die Künstlerin selbst, eine gewisse Catherine Kay Greenup, steht dort bloß, sie sei an MS erkrankt und habe bis zur Rente gearbeitet. Auch übrigen Internet findet sich nicht mehr über sie, weshalb ich diese Informationen weder bestätigen noch widerlegen kann. Vielleicht ist sie in Wahrheit ein 25-jähriger Start-up-Gründer aus Nigeria. Vielleicht überfällt sie mit der Oma-Masche Banken oder hält Boris Johnsons Friseur auf dem Dachboden gefangen. Ich weiß es nicht. Nur das: Wenn ich eines ihrer Gemälde auf einem Flohmarkt erspähte, würde ich darum feilschen und es mitnehmen. Außerdem passte dieser Blumen gesäumte Waldweg herrlich zu den eingangs erwähnten floralen Frühlingsboten. In diesem Sinne, happy spring allerseits!
Ein Hinweis zum Schluss: Alle Empfehlungen, die ich in diesem Newsletter mit Ihnen teile, liebe Abonnenten, sind ganz persönliche und daher hochgradig subjektive Tipps. Als solche verstehen sie sich natürlich nicht als fachlicher (Experten-)Rat in irgendeiner Form, sondern haben rein unterhaltenden Charakter. Außerdem mache ich mir durch die Verlinkung weder die auf den jeweiligen Websites ausgedrückten Fakten und/oder Meinungen zu eigen, noch stehe ich in irgendeiner Geschäftsbeziehung zu Anbietern oder Machern. Für diese Unabhängigkeit zahlen Sie schließlich freundlicherweise mit Ihrem Monats- oder Jahresbeitrag. Vielen Dank, dass ich so mehr (Gedanken-)Freiheit genieße als im traditionellen Mediengeschäft. Ich hoffe, mit jeder Ausgabe der LuxusProbleme profitieren auch Sie davon bestmöglich.


