Liebe Leserin, lieber Leser,
warum ein Newsletter? Warum eine wöchentliche Flaschenpost, die möglicherweise in den Tiefen der E-Mail-Postfächer zwischen Bestellbestätigungen oder Hinweisen auf die nächste Online-Veranstaltung versinkt? Warum etwas machen, das nun jede, das nun jeder macht? Warum sich auf einen weiteren Holzweg zeitgenössischer Publizistik, deren langsames Siechtum öffentlich betrauert wird, begeben?
Zumal es auch um den gewählten Inhalt nicht gut steht. Überall tönt im Moment die Wissenschaft, die wirklich wahre Wissenschaft. Geistiges muss hingegen in pandemischen Zeiten aus guten Gründen zurückstehen und erläutern, welchen Beitrag es zum Umgang mit dem allgegenwärtigen Ausnahmezustand oder gar zur Lösung der gegenwärtigen Krise leisten kann. Gleichzeitig wird ein neuer Kampf um den Geist in bisher kaum gekannter Schärfe und mit in dieser Situation teils unverständlicher Verbissenheit ausgetragen. Wenn es um Dinge geht, die „man nicht sehen könne“, werden die Hüterinnen und Hüter des „freiheitlichen, säkularisierte[n] Staates“ (Ernst-Wolfgang Böckenförde) schnell unruhig. Man spricht von Gegenaufklärung, schreibt von einer durch kulturell-religiöse Identitätspolitik vorangetriebenen Spaltung der Gesellschaft - kurzum: Die Ordnung zerbricht. Schuld sei in letzter Instanz das Internet. Es zerstöre, indem es zu antisozialem Narzissmus, Influencertum und allerlei anderer Unbill anstifte, die Bande der alten Gesellschaft; setze den Einzelnen an die Stelle der bürgerlichen Institutionen und entfremde ihn auf diese Weise von den Anderen.
curasui stellt dieser allzu zeitgeistigen Diagnose ein anderes Programm entgegen: Nicht das Internet oder die sozialen Medien haben die Menschheit in die uns täglich erschütternden Stürme körperlicher und geistiger Gewalt geführt. Neben den politisch-ökonomischen Verwerfungen der Geschichte, die „unablässig Trümmer auf Trümmer“ (Walter Benjamin) häufen, bringt vor allem das Fehlen von Aufmerksamkeit beständig Feindschaft hervor. Fehlende Aufmerksamkeit für die Schöpfung, fehlende Aufmerksamkeit für den Anderen und nicht zuletzt fehlende Aufmerksamkeit für unser Selbst. Ein Umstand, den uns der pandemische Ausnahmezustand momentan in aller Schärfe vor Augen führt.
Aber lässt sich Aufmerksamkeit lernen und wie? Die französische Philosophin, Mystikerin und politische Aktivistin Simone Weil (1909-1943) schrieb mit der ihr eigenen Vehemenz, dass die „echten und reinen Werte des Wahren, Schönen und Guten im Tun und Handeln eines Menschen […] durch ein und denselben Akt hervorgebracht [werden]: durch eine gewisse Anwendung der Fülle der Aufmerksamkeit auf den Gegenstand“ (Simone Weil: Schwerkraft und Gnade, Berlin 2021, S. 131). Selbst wenn wir ihren ungebrochenen Glauben an eine Verfeinerung des Geistes nicht mehr uneingeschränkt teilen wollen, weist uns dieser Aphorismus auf bisher Unabgegoltenes hin: Dass sich das Selbst in der Verschwendung an den Gegenstand öffnen und verwandeln könne. Dieser Newsletter macht sich derartige Verschwendung zur Aufgabe und stellt Texte, Bröckchen vom geistigen Brot, und ihre kleinteilige Betrachtung in den Mittelpunkt; erkundet die ethische Wirksamkeit einer derartigen Schule der Aufmerksamkeit, die sich vielleicht nicht nur auf den Einzelnen, sondern auch auf eine noch zu bildende Gemeinschaft erstreckt: Digitale Selbstsorge als Sorge um den Anderen.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird dieser immer am Sonntagabend erscheinende Newsletter zukünftig aus vier, nicht zwingend verbundenen Teilen bestehen: I. einer Rückschau, die die vergangene Woche aus philosophisch-theologischer Perspektive in der Nussschale zusammenzufasst; II. einer der katholischen Leseordnung folgenden Meditation zum jeweiligen Sonntagsevangelium; III. einer Vorstellung eines historischen Wissensbestands zum Lesen, Schauen oder Hören sowie IV. einer freien Sektion, die entweder einem Gastbeitrag oder einem spezifischen Thema gewidmet ist.
II.
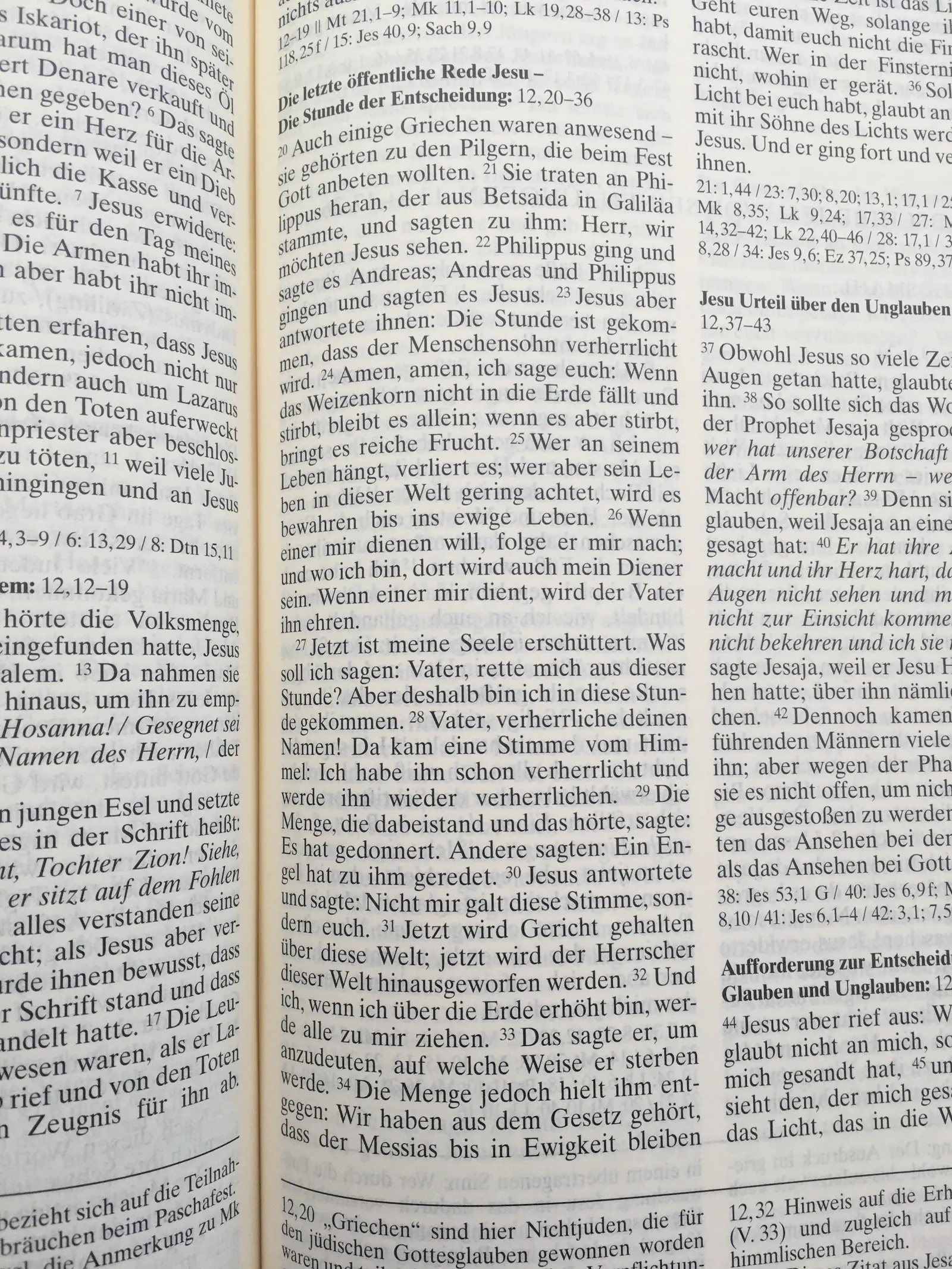
Am fünften Fastensonntag konfrontiert uns die heilige Schrift (Joh 12, 20-33) mit bedrohlichen Worten, die für heutige Ohren geradezu anstößig wirken: Nicht nur fordert Jesus die Menge in seiner Rede dazu auf, ihr Leben zugunsten des kommenden Gottesreiches gering zu schätzen oder gar hinzugeben, sondern deutet auch sein eigenes Schicksal und das damit verbundene Weltgericht an. Der Heiland wirkt damit auf uns zunächst wie der Bonner Philosoph Markus Gabriel, der in regelmäßigen Abständen vor einem Verlust der Freiheit, des spezifisch Menschlichen im Angesicht der Pandemie sowie einem damit verbundenen Absolutismus des nackten Lebens zu warnen pflegt. Allerdings sagt Jesus, wenn wir das von ihm zur Darstellung einer diskursiv nur schwer erläuterbaren Wahrheit angebrachte Gleichnis sorgfältig nachvollziehen, eher Gegenteiliges:
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben.“ (Joh 12, 24-25)
Saatgut, das nicht ausgesät wird und sich dem Boden verweigert, bringt sich um die eigene Verwandlung; erst die Bereitschaft zur Selbstverneinung ermöglich ihm, ein ganz Anderer zu werden. Somit möchte Jesus nicht unsere Lebensform retten, sondern unsere beständig genährte Sehnsucht nach Selbsterhaltung, nach der Bewahrung einer für die Ewigkeit ausgebildeten Lebensform, infrage stellen. Gleichwohl ist diese Negation nicht ohne die Befassung mit der eigenen Lebensform zu haben - im Gegenteil, diese Verneinung bildet selbst eine am Bild der Nachfolge orientierte Lebensform aus:
„Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren.“ (Joh 12,26)
Diese Lebensform unterscheidet sich allerdings beträchtlich von einer auf den Einzelnen und seine Selbsterhaltung perspektivierten Lebensform. Sie ist Leben im und durch den Anderen. Der Nachvollzug des Anderen, sein exemplum, lässt den Einzelnen außer sich geraten, ermöglicht im wahrsten Sinne des Wortes Ekstase. Im Licht dieser Erörterungen erhellen sich uns auch die zuvor als bedrohlich charakterisierten Passagen über den kommenden Prozess:
„Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt; jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden.“ (Joh 12,31)
Eine durch Negation und die Ekstase des exemplums geborene prekäre Lebensform zeitigt nicht nur für den Einzelnen, sondern auch die ihn umgebende Welt Konsequenzen. Indem der Einzelne dieser Welt entzogen wird, indem er vom „Ernstfall“ (Hans Urs Balthasar) ergriffen wird, setzt er selbst ein gleichsam provozierendes und anziehendes exemplum. Jesus ist wiederum der Ernstfall des Ernstfalls, nicht Imperativ: Jeder Mensch muss - den Anregungen dieses Evangeliums folgend - dem ihm zugeteilten Ernstfall selbst erkunden.
III.
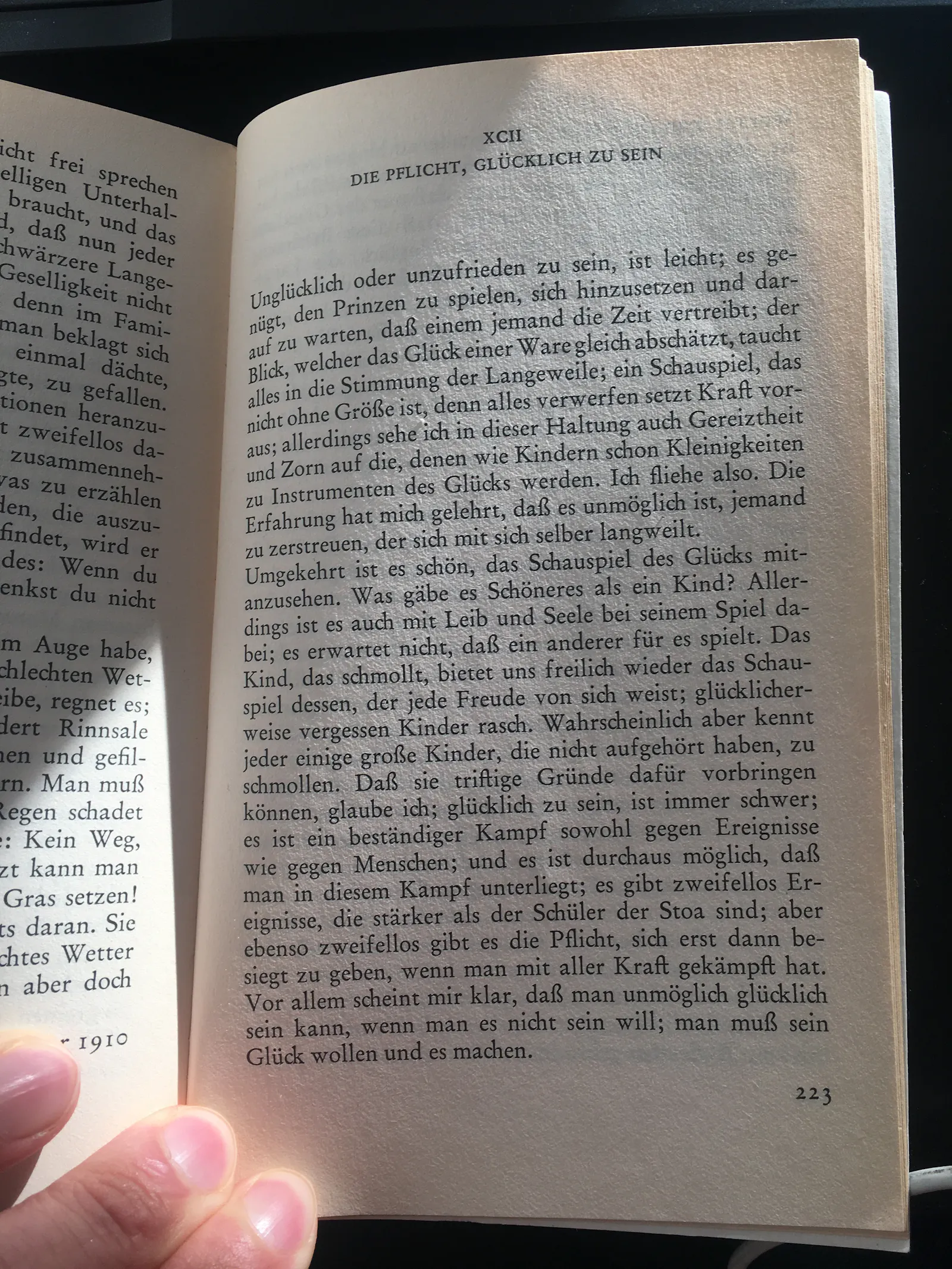
Von einer derartigen Aufgabe erzählt uns auch Émile Chartier (1868-1951), genannt Alain, der als „Montaigne des 20. Jahrhunderts“ und Lehrer zahlreicher Größen der französischen Geistesgeschichte große Bekanntheit erlangte. Seine an der französischen Moralistik geschulten und als „Propos“ bezeichneten Essays entwerfen eine gebrochene, nie zum Abschluss gelangende Ethik, die beständig die Frage nach der Bedeutsamkeit innerer Verwandlung für das Heil des Einzelnen stellt. Der titelgebende Essay (16.03.1923) der wohl in Deutschland bekanntesten Sammlung Die Pflicht, glücklich zu sein (Frankfurt am Main 1982) konfrontiert uns - den provokativen Ton Jesu nachahmend - mit der Selbstzufriedenheit des nörgelnden Menschen:
„Unglücklich oder unzufrieden sein, ist leicht; es genügt den Prinzen zu spielen, sich hinzusetzen und darauf zu warten, daß einem jemand die Zeit vertreibt […].“ (S. 223)
Sein Unglück ist dem Unglücklichen Lebensform genug. Es verlangt keinerlei Anstrengung, bietet verlässliche Langeweile, verunmöglicht aber auch ein Ende dieses Zustands. Ähnlich wie Jesus scheint Alain Heil nur in einer dem Einzelnen aufgegebenen, sich selbst aufs Spiel setzenden und damit das Selbst verwandelnden Tätigkeit möglich:
„[…] [G]lücklich zu sein, ist immer schwer; es ist ein beständiger Kampf sowohl gegen Ereignisse wie gegen Menschen; und es ist durchaus möglich, daß man in diesem Kampf unterliegt; es gibt zweifellos Ereignisse, die stärker als der Schüler der Stoa sind; aber ebenso zweifellos gibt es die Pflicht, sich erst dann besiegt zu geben, wenn man mit aller Kraft gekämpft hat. Vor allem scheint mir klar, daß man unmöglich glücklich sein kann, wenn man es nicht sein will; man muß Glück wollen und es machen.“ (S. 223)
Entscheidend ist somit wieder eine bewusste Entscheidung zur Nachfolge, eine Abwendung, die den Einzelnen aus der Welt des Unglücks reißt und auf diese Weise auch auf die ihn umgebende Welt, die Schöpfung, den Anderen zurückwirkt:
„Deshalb gibt es nichts Wichtigeres in der Liebe als das Gelöbnis, glücklich zu sein. Was wäre schwerer zu ertragen, als die, welche man liebt, traurig oder unglücklich zu sehen?“ (S. 224)
Das ständig im Scheitern begriffene, aber jedem Einzelnen aufgegebene Drama des Glücks eröffnet für Alain auf diese Weise den Blick auf eine so vereinte menschliche Gesellschaft, die in der Sehnsucht nach dem gemeinsamen Glück den Versuchungen der Unzufriedenheit und der Langeweile widersteht.
In der kommenden Woche wird curasui um Sektion IV ergänzt. Ob es sich hier hierbei um einen Gastbeitrag oder ein freies Thema handelt, steht allerdings noch nicht fest. Ein besonderes Dankeschön geht an diejenigen Mitglieder, die bereits ihr Scherflein oder ihre Gabe diesem Newsletter widmen - ein großer Dank aber auch an alle, die aufmerksam mitlesen!
Herzlichst
Louis Berger


