Wer war Peter G.?
Über ein Rattenherz und einen rätselhaften Fund in Berlin, über das mutige Schweigen von Jürgen Fuchs und den Schwindel beim Blick in die Abgründe der Diktatur

Es war ein sonniger Vormittag im Mai, als ich am Alexanderplatz aus der S-Bahn stieg, um in der Gegend um die Volksbühne ein wenig herumzustreunen. Zwei Tage war ich in Berlin und eilte von einer Verabredung zur nächsten. Aber dann war da diese eine Stunde, in der ich nichts vorhatte und mich treiben ließ: durch Straßen und an Cafés vorbei, in denen ich oft gesessen hatte, als ich noch in Berlin lebte. Alles sah anders aus, aber verändert hatte sich nichts.
Plötzlich sah ich das Straßenschild. Ich las „Almstadtstraße“, und in diesem Moment fiel mir Adolf Endler ein. Zwei Jahre vor seinem Tod hatte er mir aus seinem Leben erzählt, das voller Brüche und Zick-Zack-Wege war. Wie er als Kind den Krieg erlebt und im zertrümmerten Düsseldorf angefangen hatte, Gedichte zu schreiben, und warum er später in die DDR gegangen war. Denke ich an diese Gespräche, sehe ich ihn, wie er mir in seiner Pankower Wohnung gegenübersitzt. Die gerunzelte Stirn, in die er sich die Brille geschoben hat; sein offener Blick aus wachen, manchmal listig zwinkernden Augen.
In der Almstadtstraße hatte er eine Zeitlang gewohnt. In den sechziger Jahren, erklärte er mir, sei das eine unheimliche Gegend gewesen. „In dieser Straße im Scheunenviertel geschahen ganz merkwürdige Dinge. In einem Winter habe ich dreißig oder vierzig Ratten mit Briketts erschlagen; eine furchtbare Metzelei war das. Man hatte das Gefühl, das Haus bricht auseinander. Oder man stellte eine Rattenfalle auf, und da steckte eine drin, und eine zweite lag tot daneben. Da war mal ein Rattenvertilger da, der sagte: ‚Ist ganz klar! Das war die Frau von dem. Die hat einen Herzschlag gekriegt vor Schreck, als sie sah, daß ihr Mann tot war.‘ Seither weiß ich, daß Ratten auch ein Herz haben.“
Das Herz der Ratte, das vor Schreck aufgehört hat zu schlagen: Aus irgendeinem Grund hatte ich das nie vergessen. Und als ich jetzt vor dem Straßenschild stand, hatte ich Mühe, das Bild aus meinem Kopf zu bekommen. Eine Weile ging es mir noch nach, während ich weiterlief und meine Blicke schweifen ließ.
Da stieß ich auf Peter G.

Es fällt mir schwer, an einem Antiquariat vorbeizugehen. Wenigstens kurz hineinschauen möchte ich. Aber gleich darauf stehe ich mit einer Handvoll Bücher vor dem Buchstaben K und gehe in Gedanken die Namen durch, die bis zum Ende des Alphabets noch zu erwarten sind, was mir zuverlässig den Angstschweiß auf die Stirn treibt ...
Diesmal lauerten die Verlockungen schon vor der Ladentür. Auf einem Fenstersims stand eine Bücherkiste. Ein neugieriger Blick – und schon war es um mich geschehen. Wenig später hielt ich drei Bücher in der Hand. Taschenbücher, in den achtziger Jahren in der DDR erschienen. Fast vierzig Jahre war das her: so lange, wie dieser Staat existiert hatte. Doch anders als die DDR bei ihrem Untergang sahen die Bücher fast aus wie neu. Keine geknickten Ecken, keine Eselsohren; das Papier kaum vergilbt.
Am verlockendsten aber war ihr Inhalt. Helga Schubert und Wolfgang Kohlhaase: das waren Namen, die im Osten jeder kannte, der Bücher las und Filme sah. Auch im wiedervereinigten Deutschland hatten sie für Aufsehen gesorgt: Helga Schubert, als sie vor zwei Jahren den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann, Wolfgang Kohlhaase mit seinen Drehbüchern von „Sommer vorm Balkon“ und „Die Stille nach dem Schuß“.
Erfüllt vom Finderglück, blätterte ich in den Büchern. „Schöne Reise“ stand auf dem einen, „Silvester mit Balzac“ auf dem anderen. Der dritte Band stammte von Balzac selbst. „Ferragus“, eine Erzählung aus der Menschlichen Komödie, die mit den Worten beginnt: „In Paris gibt es Straßen, die entehrt sind wie ein Mensch, der eine Schurkerei begangen hat ...“
Gegen Abend, der Zug ratterte gen Norden, nahm ich die Bücher hervor: unschlüssig, welches ich zuerst lesen sollte. Da sah ich den Stempel. Das heißt, ich sah die sechs Stempel. In jedem Band zwei: einer auf dem Vorsatzblatt, einer auf der dritten Umschlagseite. Schwarzgrau stand da der Name des vormaligen Besitzers: Peter G. Alle drei Bücher hatten ihm gehört.
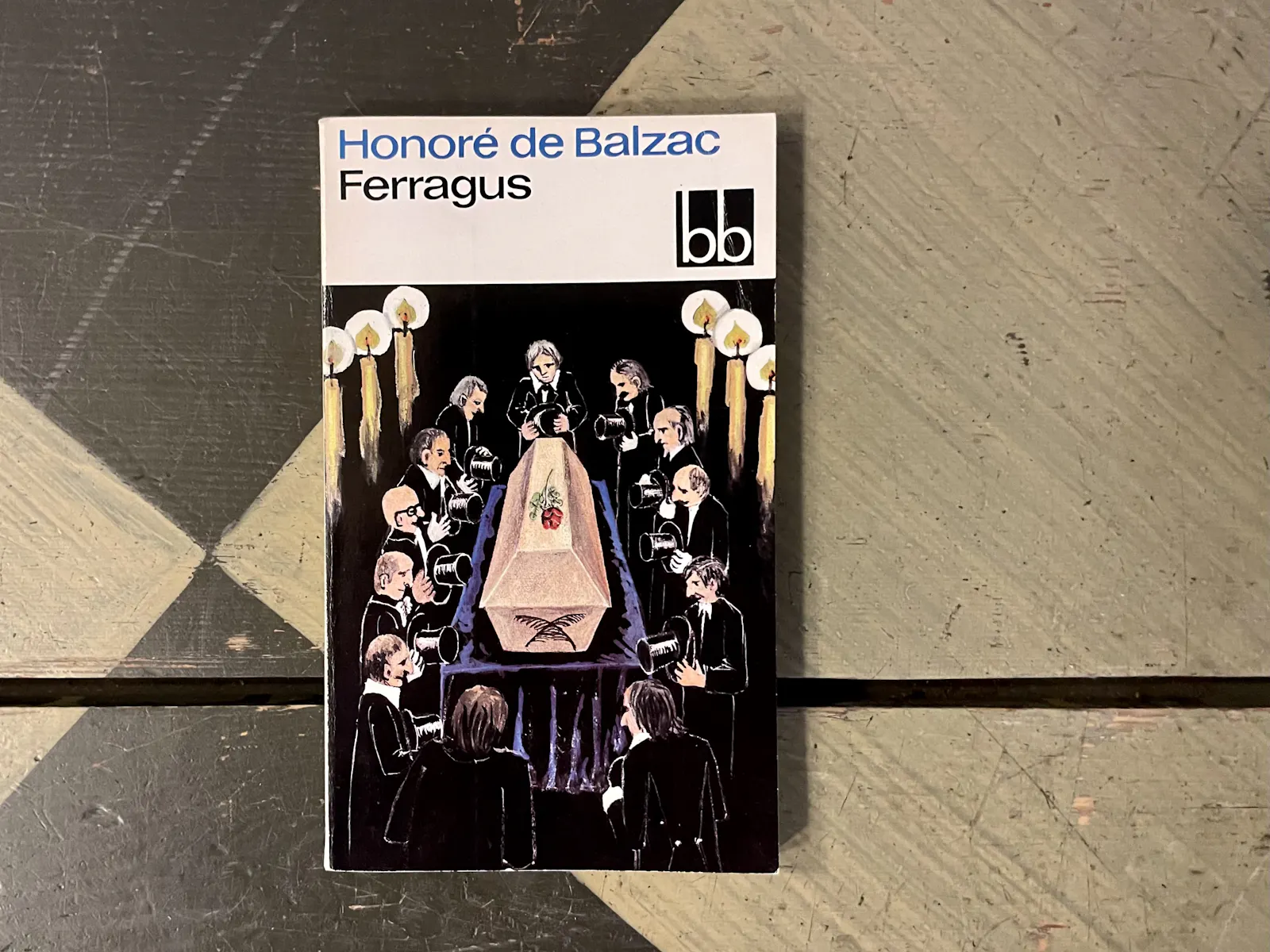
Wie gelangen Bücher in ein Antiquariat? Jemand sortiert sie aus, weil er keinen Platz mehr hat, sie nicht mehr lesen will. Oder ein Haushalt wird aufgelöst, weil jemand gestorben ist und die Nachkommen mit Büchern nichts anzufangen wissen.
Bei Peter G. schien mir das zweite wahrscheinlicher. Die Stempel, aber auch ihr guter Zustand wiesen darauf hin, daß ihm Bücher etwas bedeuteten – bedeutet hatten. Wer er wohl gewesen war? Ich stellte mir einen älteren Herrn vor: grauhaarig, mit Hornbrille. Einen Intellektuellen, der im Prenzlauer Berg sein eigensinniges Leben geführt hatte; nur ein paar Straßen entfernt von dem Laden, in dem jetzt der Rest seiner gepflegten Büchersammlung in ein paar Bananenkisten lag, zusammen mit Dutzenden abgegriffenen Bänden.
Der Gedanke ließ mir keine Ruhe. Ein paar Tage später tippte ich den Namen in die Tastatur – und überflog gespannt die Suchergebnisse. Ich las „sozialistische Diktatur“, ich las „Überwachung“ und „geheimdienstliche Ermittlungsmethoden“. Und ich sah den Namen von Jürgen Fuchs, der 1976 in der DDR verhaftet und nach neun Monaten im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen in den Westen abgeschoben worden war.
War G. ein Freund von Fuchs gewesen? Ein Büchermensch aus der ostdeutschen Dissidentenszene? Es sah ganz so aus, als wäre ich auf der richtigen Spur.
Ich las den Essay über Jürgen Fuchs, der im Mai 1999 an einem seltenen Blutkrebs gestorben war: mit 48 Jahren. Man vermutet, daß er während seiner Haft verstrahlt wurde, so wie auch andere Oppositionelle, die später an Krebs starben. Vor seinem Tod ging Fuchs diesem Verdacht nach und fand tatsächlich Hinweise, daß die Stasi radioaktive Substanzen gegen Menschen eingesetzt hatte.
Zu verwundern braucht einen das nicht, wenn man sich vor Augen führt, mit welcher Menschenverachtung der ostdeutsche Geheimdienst operierte. Die unverhüllte Drohung, die man Fuchs vor seiner Zwangsausweisung mit auf den Weg gab, spricht für sich: „Legen Sie sich später nicht mit uns an. Wir finden Sie überall. Auch im Westen. Autounfälle gibt es überall.“ Einem Bombenattentat in West-Berlin entgingen er und seine Familie nur um Haaresbreite.
Über die Zeit seiner Haft hat Jürgen Fuchs ein beklemmendes Buch mit dem Titel „Vernehmungsprotokolle“ geschrieben. Akribisch erinnert er sich darin an jedes Detail – bis hin zum Wortlaut der Verhöre. Das Buch ging mir lange nach, als ich es vor Jahren las. Damals fuhr ich nach Hohenschönhausen und ließ mich von einem der ehemaligen Häftlinge durch das Gefängnis führen. Mich fröstelte, obwohl es ein Sommertag war.
Während ich jetzt über Fuchs las, spürte ich wieder die Beklemmung von einst. Und plötzlich hielt ich den Atem an. „Sein erster Vernehmer“, las ich, „war der damals 36jährige Major Peter G., ein Mann mit krakeliger Handschrift, der in der Ermittlungsabteilung stellvertretender Referatsleiter war.“
Ich las den Satz ein zweites und ein drittes Mal. Ich war so überrascht, daß ich es zuerst nicht glauben konnte. Aber da stand es schwarz auf weiß: Der Mann, den ich suchte, war kein bücherliebender dissidentischer Geist, sondern ein Offizier der Staatssicherheit.
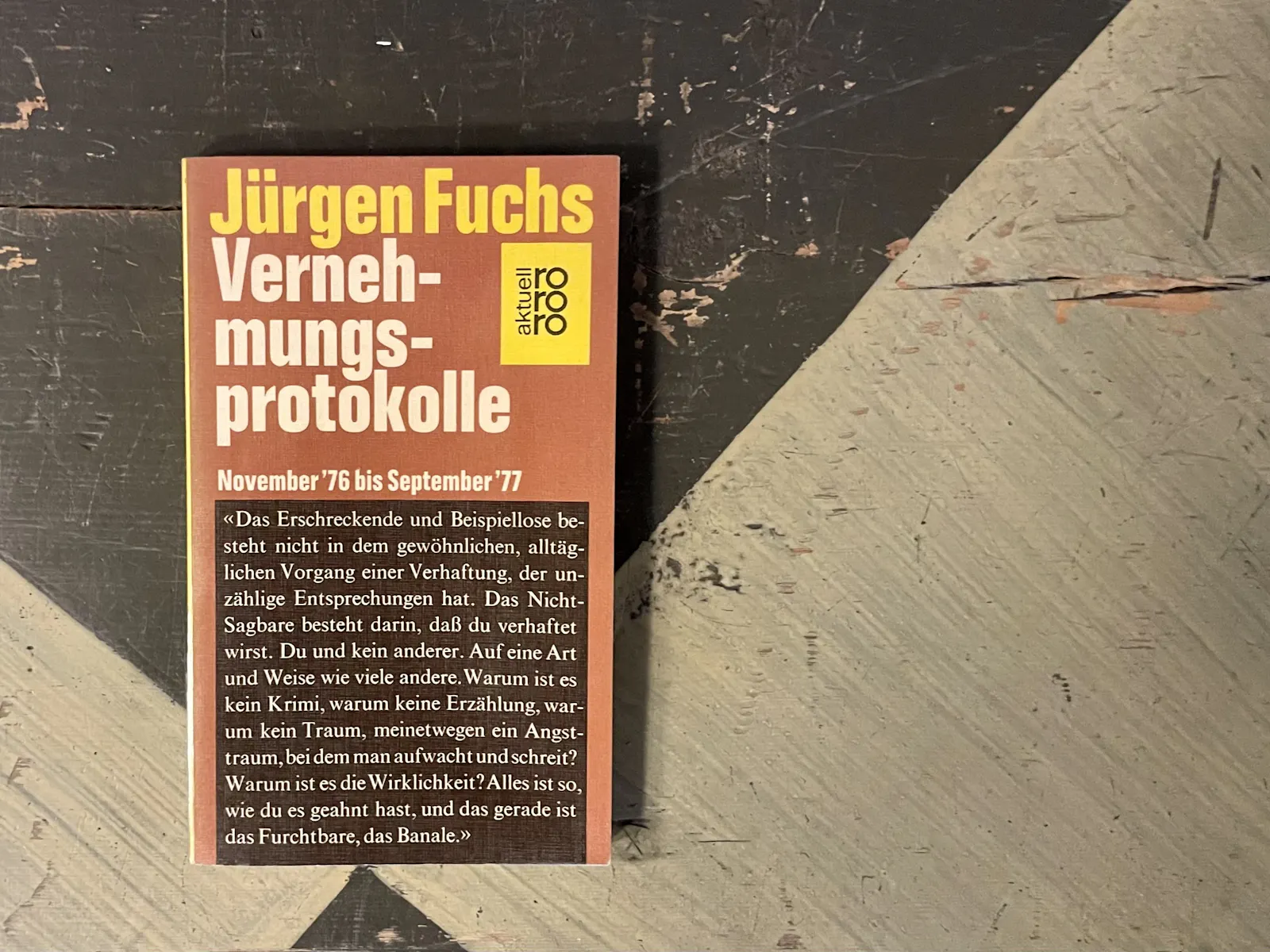
An diesem Tag verbrachte ich Stunden damit, im Internet nach Peter G. zu suchen. Es gab mehrere Personen dieses Namens, die alle nicht in Berlin lebten. Daß der Vorbesitzer meiner Bücher Berliner gewesen war, dafür sprach aber schon die Tatsache, daß ich sie dort gekauft hatte. Und nicht zuletzt die Buchhandlung selbst ließ es plausibel erscheinen, daß es sich um jenen Stasi-Major handelte: Sie lag im Erdgeschoß des Karl-Liebknecht-Hauses, das zu DDR-Zeiten der SED gehört hatte und in dem heute die Partei „Die Linke“ ihre Geschäftsstelle hat.
Gegen Abend radelte ich in die Bibliothek und fand ein Buch, in dem von Peter G. die Rede ist. Es war vor über zwanzig Jahren erschienen und sah nicht so aus, als ob es in dieser Zeit einmal entliehen wurde. Ich las, daß G. 1975 zum stellvertretenden Leiter des Referats II der Hauptabteilung IX/2 ernannt worden war, dem als Referatsleiter ein Major E. vorstand. Wegen „mangelnder Eignung“ wurde er im März 1978 von dieser Funktion entbunden und seitdem als Offizier für Sonderaufgaben eingesetzt. Zu seinen Aufgaben zählte die „Aufarbeitung und Auswertung spezifischer Materialien auf dem Gebiet der Bekämpfung des staatsfeindlichen Untergrundes“.
Daß die Degradierung ausgerechnet in der Zeit geschah, als Jürgen Fuchs in Hohenschönhausen inhaftiert war, kann vieles bedeuten – nur eins nicht: In den „Vernehmungsprotokollen“ findet sich kein Hinweis darauf, daß G. besonders menschenfreundlich aufgetreten wäre, was womöglich seinen eigenen Leuten mißfallen hätte. Fuchs beschreibt den ersten seiner insgesamt fünf Vernehmer als Brillenträger mit Aktentasche, der Brecht und Biermann zitiert, auf die „Schachnovelle“ anspielt und Fuchs abspricht, Schriftsteller zu sein. Sein Ton ist spöttisch bis zynisch, selten übersteigen seine Drohungen Zimmerlautstärke; selbst seine Beleidigungen („dreckiger, kleiner Schwindler“) wirft er seinem Gegenüber nur hin wie einen nassen Lappen.
Ist das wirklich der Mann, in dessen Regal fein säuberlich aufgereiht die Bücher von Helga Schubert und Wolfgang Kohlhaase standen?
Weder die eine noch der andere waren staatstragend. Im Gegenteil: Für ihren Erzählband „Das verbotene Zimmer“ verweigerte man Schubert 1981 die Druckgenehmigung. „Was Sie über unsere Partei schreiben“, erklärte man ihr im Aufbau-Verlag, „ist wie ausgekotzt. Hören Sie auf zu schreiben! Das ist Analphabetismus.“ Wolfgang Kohlhaase erging es nicht besser. Der Film „Berlin um die Ecke“, für den er das Drehbuch geschrieben hatte, wurde 1965 im Zuge des berüchtigten elften Plenums wegen seiner „pessimistischen und subjektivistischen Grundhaltung“ noch im Rohschnitt verboten.
In den zwei Büchern, denen G. seinen Stempel aufdrückte, ist von sozialistischer Herrlichkeit nichts zu finden. Dem Vernehmer von Jürgen Fuchs müssen diese Erzählungen fast schon subversiv, zumindest ideologisch fragwürdig vorgekommen sein.
Oder ist das des Rätsels Lösung? Waren diese Bücher für ihn Arbeitsmittel, mit denen er sich für die „Bekämpfung des staatsfeindlichen Untergrundes“ wappnete? Aber nein, denke ich sofort, dann hätte er sie wohl kaum so pfleglich behandelt. Obwohl man ihnen ansah, daß sie gelesen waren, fand ich darin keinen Knick und keine Unterstreichung.
Der zweite Stasi-Mann, der Fuchs vernahm, war der schon erwähnte Referatsleiter, Major E. In den „Vernehmungsprotokollen“ wird er als aggressiv und aufbrausend geschildert. Die Sprache der Macht, gepaart mit kalter Brutalität. „Was gibt’s denn da zu glotzen?“ fährt er den Häftling an. „Und jetzt packen Sie aus!“ Doch auch er schafft es nicht, Fuchs zum Reden zu bringen – so wenig wie Peter G. und die anderen drei Vernehmer. Fuchs schweigt stundenlang; mit dem Finger malt er Buchstaben und Wörter auf die Tischplatte, in die Luft.
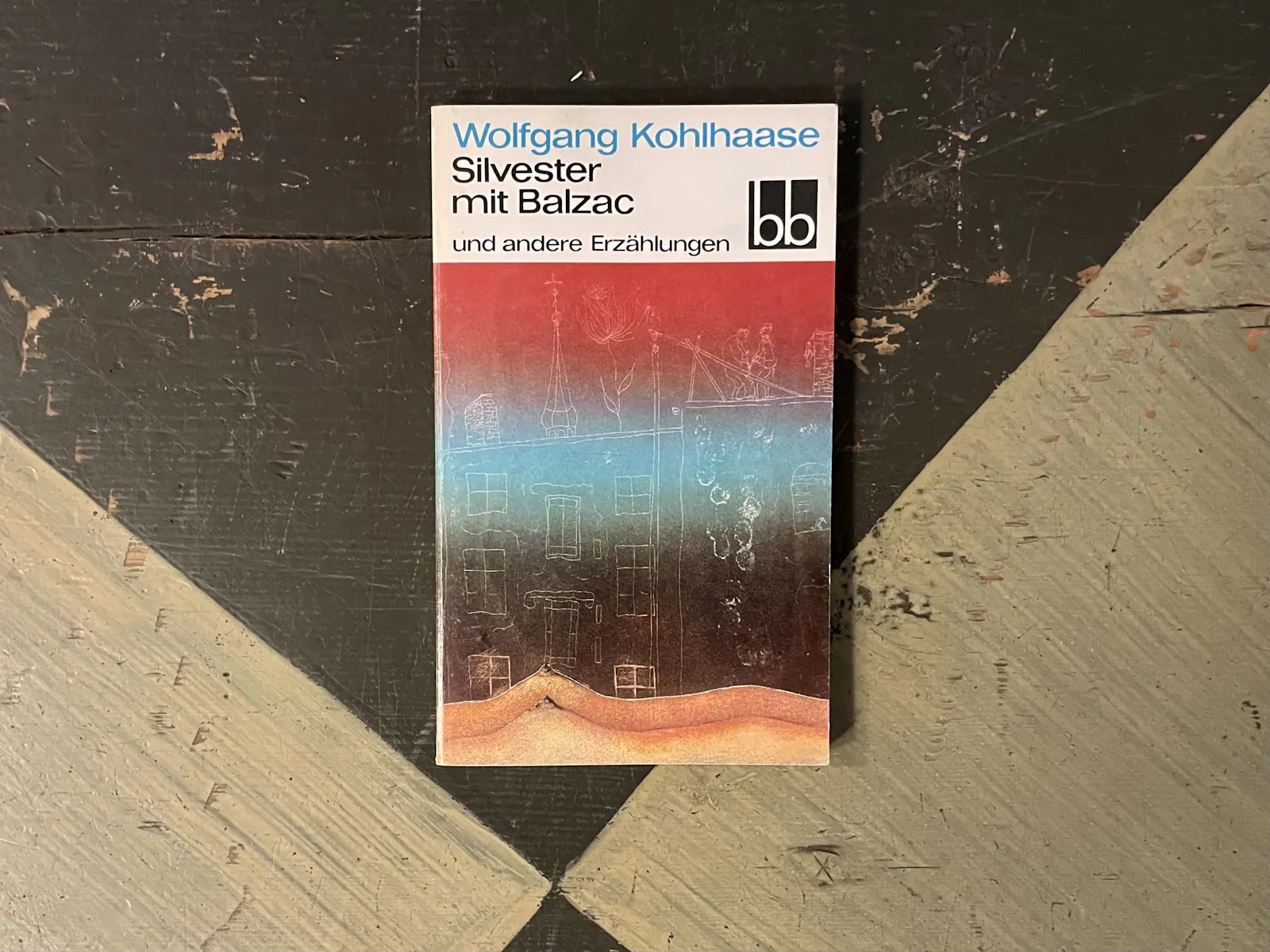
Der einstige Major E. ist heute als Sozius einer Anwaltskanzlei tätig. Das Foto auf deren Website zeigt einen Mann mit wuchtigem Kinn und schmalen Lippen. Unter seiner Berliner Telefonnummer steht: „Refugees Welcome“. Ich würde gern wissen, was Rechtsanwalt Dr. E. heute über die Flüchtlinge denkt, die an der Berliner Mauer erschossen oder schwer verletzt ins Haftkrankenhaus in Hohenschönhausen eingeliefert wurden.
Aber nicht danach fragte ich ihn, als ich ihm kurzentschlossen eine Mail schickte, um etwas über seinen früheren Kollegen herauszufinden. Nach drei Tagen war die Antwort da: „Zu meinem Bedauern muß ich Ihnen mitteilen, daß ich seit Jahrzehnten keinen Kontakt zu Herrn Peter G. habe; ich weiß auch nicht, ob er noch unter den Lebenden weilt.“
Fast war ich erstaunt, daß er zurückschrieb. Erstaunt, daß der Mann, der vor einem halben Jahrhundert Jürgen Fuchs in die Mangel genommen hatte, noch immer da war. Daß er in diesem Augenblick durch Berlin ging oder in einem der östlichen Bezirke in seinem Büro saß, vor sich eine Tasse Kaffee. Ich sehe ihn vor mir, wie er die Lippen zusammenkneift und seinen Körper strafft. Die rasche Handbewegung, mit der er die Erinnerung an Peter G. verscheucht.
Immerhin, eine Antwort. Meine Anfrage an den Buchladen im Karl-Liebknecht-Haus wurde dagegen mit Schweigen quittiert. Zweimal faßte ich nach, vergebens. Offenbar war jedes Wort, das mir etwas über den Vorbesitzer meiner Bücher verraten konnte, eines zu viel.
An diesem Punkt brach ich die Suche ab. Sicher, es hätte noch Wege gegeben, mehr über G. in Erfahrung zu bringen. Beim Einwohnermeldeamt hätte ich sein Sterbedatum erfahren, seine letzte Adresse. Und dann war da noch dieser andere Fund: In einem Buch über die Wärter und Vernehmer in Hohenschönhausen stieß ich auf die Nummer der Kaderakte von Peter G. Ich las, daß er die Ablösung als stellvertretender Referatsleiter selber beantragt hatte, weil er sich „physisch und psychisch den gestellten Anforderungen nicht mehr gewachsen“ fühlte. Hatte er sein eigenes Tun nicht länger ertragen?
Nur: handelte es sich bei dem Gesuchten tatsächlich um den Vernehmer von Jürgen Fuchs? Weder das Einwohnermeldeamt noch die Stasi-Akten hätten mir diese Frage beantworten können. Geschweige denn jene andere Frage, die mir unentwegt durch den Kopf geht, seit ich auf die wahrscheinliche Identität von Peter G. gestoßen bin: Wie kann jemand, der solche Bücher liest, fähig sein, einen anderen zu erniedrigen, zu beschimpfen, zu quälen?
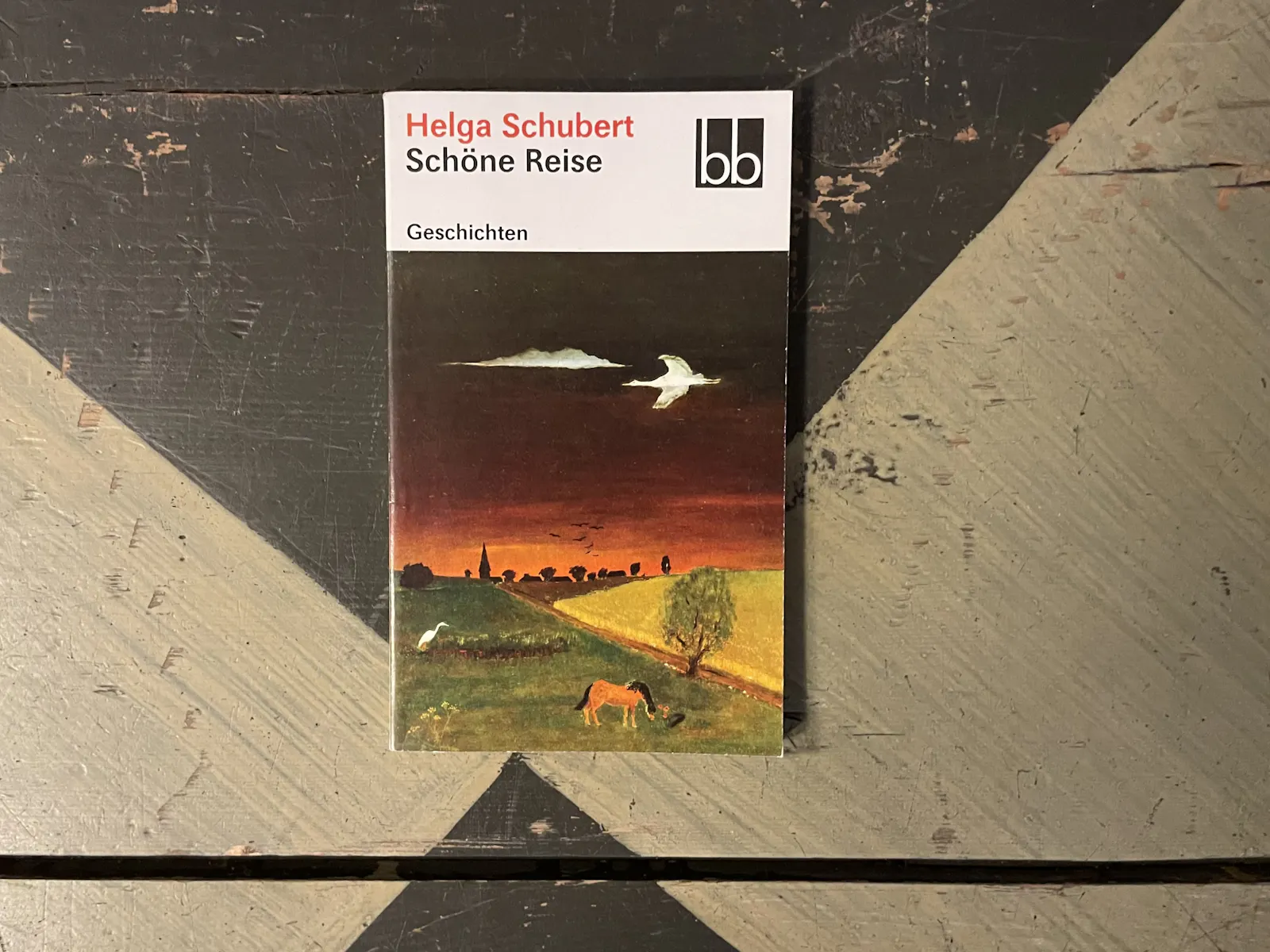
Im Oktober, nach ihrer Lesung in Lüneburg, saß ich mit Helga Schubert zusammen. Es war der Tag, an dem die Nachricht von Wolfgang Kohlhaases Tod die Runde machte; im Alter von 91 Jahren war er in Berlin gestorben. Helga Schubert war ihm ein paarmal begegnet, auch sie bewunderte seinen Erzählband „Silvester mit Balzac“. Ich erzählte ihr von meinem antiquarischen Fund, von meiner Suche nach Peter G. und meiner Ratlosigkeit.
Wer hätte mir besser Auskunft geben können als sie, die lange als Psychotherapeutin tätig war, die sich immer wieder mit den Mechanismen der Diktatur beschäftigt und ein Buch über Denunziantinnen im Dritten Reich geschrieben hat? Im Vorwort der Neuauflage von „Judasfrauen“ nennt sie die Diktatur „eine furchtbare, eine Grauen erregende, eine verführerische, Leben zerstörende Täterin“.
Helga Schubert überlegte nicht lange. „Die waren ja nicht dumm. Das waren ganz normale, zum Teil sehr gebildete Leute. Nur daß sie in ihrer plötzlichen Machtfülle der Versuchung zu verletzendem und zynischem Verhalten nicht widerstehen konnten. Die Diktatur hat sie zu Tätern gemacht.“
Das heißt, fragte ich, in der Diktatur kann jeder zum Täter werden?
„Man muß schon vor der Versuchung gefestigt sein.“
Und die Bücher? Was mache ich mit denen?
„Die stellen Sie einfach in Ihr Regal.“

Nachdem sie ein halbes Jahr auf meinem Schreibtisch und neben dem Bett gelegen und mich auf Reisen begleitet hatten, habe ich die drei Aufbau-Taschenbücher heute in mein Regal gestellt. „Schöne Reise“ neben „Judasfrauen“, Kohlhaase neben Kempowski, „Ferragus“ neben „Verlorene Illusionen“. Dann nahm ich noch einmal die „Vernehmungsprotokolle“ zur Hand. Mir war etwas eingefallen.
Wenn Jürgen Fuchs von November 1976 an neun Monate inhaftiert gewesen war, hieß das nicht ...? Tatsächlich, in den Aufzeichnungen aus seiner Haftzeit gab es einen Eintrag vom Tag meiner Geburt. Da das ein Sonntag war und noch dazu ein Feiertag, blieb Fuchs die Begegnung mit seinem Vernehmer erspart. Ich las: „Ich höre eine Blaskapelle. Irgendwo draußen. Sie spielt Märsche.“ Und dann: „Im Hof oder in einem der Nebengebäude läuft ein Tonband: alte Schlager von den Beatles und den Rolling Stones. Heute ist der 1. Mai.“
Daß der Staat, in den ich an diesem Tag hineingeboren wurde, von der Landkarte verschwand, noch bevor es für mich ernst wurde, verdanke ich auch Jürgen Fuchs. Die Flugblätter, die zur entscheidenden Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 in Leipzig aufriefen, waren auf einer illegalen Druckmaschine hergestellt, die er, in Einzelteile zerlegt, über die Grenze geschickt hatte.
Als die Mauer fiel, war ich zwölf. Die Zukunft lag vor mir wie eine weiße Seite. Jetzt brauchte ich mich nur noch zwischen den Beatles und den Stones zu entscheiden. Die Märsche hatte ich hinter mir.
Diese Geschichte habe ich am 11. Dezember 2022 an 371 Leserinnen und Leser verschickt. Wenn auch Sie meine Geschichten erhalten wollen, tragen Sie sich gern hier ein:
Eine Geschichte wie diese schreibt sich nicht von allein. Um so dankbarer bin ich allen, die mit einer Mitgliedschaft meine freiberufliche Arbeit an „Wolken und Kastanien“ ermöglichen. Das geht schon zum Preis einer Tasse Kaffee im Monat. Wollen auch Sie Unterstützer(in) werden? Das geht hier: